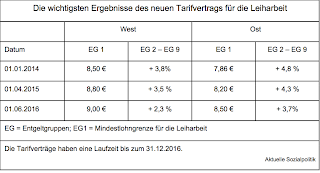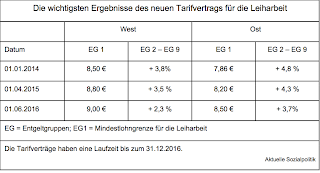Der Jesuit und Sozialethiker Friedhelm Hengsbach hat sich zu Wort gemeldet zum Thema Mindestlohn – und sein Beitrag Mindestlohn und Lohnuntergrenzen ersetzen keine Tarifverträge aus dem März dieses Jahres sei hier zur Lektüre empfohlen. Hengsbach – ein Mahner aus der Tradition des Sozialkatholizismus, der als einer der führenden Sozialethiker in Deutschland gilt – geht einer interessanten Vermutung nach. Hengsbach fragt sich, »ob die Debatte über den Mindestlohn eine Nebenarena darstellt, welche die Aufmerksamkeit von der Funktion und dem Gewicht der Tarifautonomie ablenkt.« Das wäre natürlich mehr als irritierend, ist der Mindestlohn doch ein Bestandteil des so genannten „Tarifautonomiestärkungsgesetzes“ der Bundesregierung, die will damit doch eigentlich die Tarifautonomie stärken.
Schauen wir uns seine Argumentationslinien an:
»Die Debatte um den gesetzlichen Mindestlohn hat inzwischen ähnlich wie die um ein bedingungsloses Grundeinkommen einen Pegel öffentlicher Erregung erreicht, der sich umgekehrt proportional zum Gewicht und zur Funktion des Tarifvertrags bzw. der Tarifautonomie verhält« (S. 10).
Hengsbach führt dann im weiteren Verlauf seines Beitrags aus, welche wichtigen positiven Funktionen den Tarifverträgen, vor allem den Flächentarifverträgen zukommt – und das nicht nur aus einer engeren ökonomischen Perspektive.
Am Ende entwickelt Hengsbach fünf interessante Hypothesen, die er im Sinne von Anfragen an das „Mindestlohnsystem“ zur Diskussion stellt:
»(1) Die staatliche Intervention in die kollektive Regelung der Arbeitsverhältnisse ist eine hoheitliche Setzung. Eine etatistische Option tritt damit neben eine korporative, zivilgesellschaftliche Option. Im Extremfall löst sie diese gar ab.
(2) Welche Kompetenz der Staat vorweisen kann, um zentral einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn zu ermitteln, der die personale, regionale und sektorale Vielfalt der Arbeitsverhältnisse berücksichtigt, bleibt verborgen.
(3) Die Rolle und Funktion, die den staatlichen Vertretern in einer Kommission zukommt, die zudem mit jeweils drei Mitgliedern der Tarifparteien besetzt wird, ist unklar. Soll der Staat als wohlwollender Beobachter auftreten, als Schiedsrichter oder als dritte Kraft, die das allgemeine Interesse vertritt? Der moderne Staat begreift sich häufig als ein Knoten in einem politischen Netzwerk, das von staatlichen Organen, Wirtschaftsverbänden und zivilgesellschaftlichen Akteuren gebildet wird. Im ungünstigen Fall etwa einer Finanzdemokratie ist er selbst Partei oder kooperative Geisel. Unter dem Druck von Lobbyisten aus Banken, Energiekonzernen und Handelsketten sitzt er der Legende einer nationalen Standortkonkurrenz auf. Er wird dann eine nur moderate Lohnentwicklung im Interesse der Exportindustrie empfehlen und die Tarifforderungen der Gewerkschaften ausbremsen.
(4) Gesellschaftliche Funktionen und Institutionen, die verschieden sind, sollten als solche unvermischt und ungetrennt präzisiert werden: Tarifverträge und Tarifverhandlungen sind zivilgesellschaftlich verankert und Bestandteil einer aktiven Beschäftigungspolitik. Ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn ist Bestandteil staatlicher Sozialpolitik.
(5) Eine arbeitsteilige beschäftigungs- und sozialpolitische Rangfolge lässt sich so skizzieren: Der Staat festigt vorrangig Flächentarifverträge und die Tarifautonomie. Er regelt gesetzlich, dass der Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband automatisch die Tarifbindung folgt. Und der Staat erklärt die Tarifverträge, die von Arbeitgebern und Gewerkschaften personen-, firmen-, branchenbezogen und regional ausgehandelt sind, unter erweiterten Bedingungen für allgemeinverbindlich.« (Hengsbach 2014: 12-13)
Der entscheidende Punkt an Hengsbach Argumentation ist die Nummer (5). Hier geht es um einen weiteren Baustein des „Tarifautonomiestärkungsgesetzes“, in dem der Mindestlohn nur eine Komponente darstellt, die zwar die öffentliche Debatte dominiert, die aber dem Grunde nach wesentlich weniger bedeutsam ist wie die angestrebte Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen.
Auch ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Wiederbelebung des Instruments der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen eine wichtige beschäftigungspolitische Ordnungsfunktion hat, deren Bedeutung angesichts der derzeit alles überlagernden Debatte über einen Mindestlohn völlig verkannt wird. Der entscheidende Unterschied zu einem Mindestlohn, der ja „nur“ eine Lohnuntergrenze darstellt, ansonsten aber alles, was darüber (nicht) passiert, nicht tangiert, führt eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines Tarifvertrags dazu, dass sich alle Unternehmen in der Branche an die tarifvertraglichen Bestimmungen halten müssen – und die umfassen eben nicht nur eine untere Lohngrenze, sondern eingeschlossen ist das gesamte Tarifgefüge. Konkret habe ich vor kurzem in einem Blog-Beitrag auf der Facebook-Seite von „Aktuelle Sozialpolitik“ über die geplante Übernahme eines Real-Marktes durch Kaufland und die Absicht des übernehmenden Unternehmens, zur Vermeidung der Pflichten aus dem Betriebsübergang das Geschäft ein Jahr lang „umzubauen“, um sich auf diesem Wege vor allem der vielen älteren Mitarbeiter entledigen zu können, darauf hingewiesen, dass es zumindestens erhebliche Bremswirkungen geben würde für die permanenten Versuche, im Einzelhandel über Lohndumping und Personalaustausch Kostenvorteile gegenüber den Wettbewerbern zu erringen, wenn der Tarifvertrag dort allgemein verbindlich wäre.
Im „Tarifautonomiestärkungsgesetz“ wird dazu ausgeführt (vgl. BT-Drs. 18/1558):
»Das Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung ermöglicht eine Abstützung der tariflichen Ordnung. Der Nutzung dieses Instruments steht in Zeiten sinkender Tarifbindung das Erfordernis des starren 50 Prozent-Quorums zunehmend entgegen.
Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz bietet eine Möglichkeit zur Geltungserstreckung von Tarifverträgen durch Rechtsverordnung. Diese Möglichkeit ist bislang auf einige wenige abschließend aufgezählte Branchen begrenzt. Künftig soll diese Erstreckung zugunsten inländischer und ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichermaßen in allen Branchen möglich sein.«
Und weiter:
»Das bisher geltende starre 50 Prozent-Quorum für die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrages wird gestrichen. An seine Stelle tritt ein konkretisiertes öffentliches Interesse. Durch das Erfordernis eines gemeinsamen Antrags der Tarifvertragsparteien ist sichergestellt, dass die Sozialpartner eine Abstützung der tariflichen Ordnung für notwendig erachten.«
Diese Neuregelung wäre schon mal eine gewaltige Verbesserung im Vergleich zur gegenwärtigen Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es kaum noch Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen gegeben hat. Allerdings muss man sehen, dass es auch nach dieser Neuregelung erforderlich ist, dass mit beiden Tarifvertragsparteien im Tarifausschuss Einvernehmen hergestellt werden muss, so dass die Arbeitgeberseite weiterhin eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung blockieren kann, in dem sie sich der Herstellung des Einvernehmens verweigert.
Insofern wäre gerade der Einzelhandel eine wunderbare Gelegenheit für die sozialdemokratische Bundesarbeitsminister Andrea Nahles, ein wenig „Wiedergutmachung“ zu leisten – denn bis zum Jahr 2000 war die Welt des Einzelhandels eigentlich ganz in Ordnung. Denn bis zu diesem Jahr galt die Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrags. Dann wurde diese auf Druck der Arbeitgeber von der damaligen rot-grünen Bundesregierung aufgehoben. Seitdem befindet sich der Einzelhandel und vor allem die dort beschäftigten Menschen auf einer Rutschbahn nach unten, denn seitdem lohnt es sich für die einzelnen Unternehmen, zu versuchen, bei den Personalkosten den Konkurrenten nach unten zu entkommen.
In diesem Sinne: Übernehmen Sie, Frau Nahles.