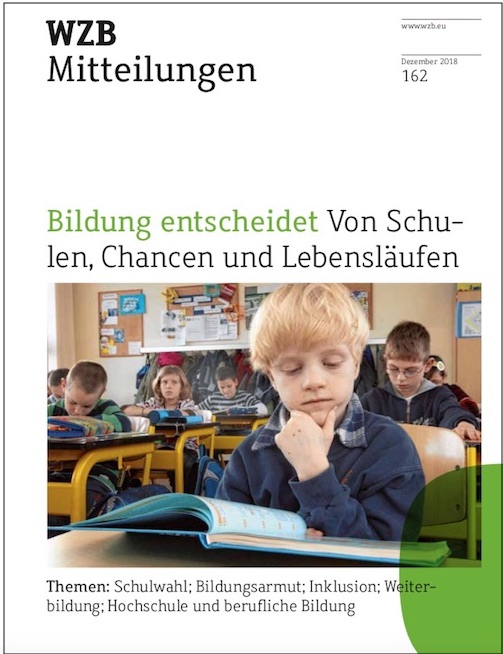»Die Deutschen unterstützen Maßnahmen zur Verringerung von Ungleichheit in der Bildung. Das ist das Ergebnis des neuesten ifo-Bildungsbarometers, für das 4000 Bundesbürger befragt wurden.« So beginnt eine Mitteilung des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung in München, die man mit dieser Überschrift versehen hat: ifo Institut: Deutsche unterstützen Maßnahmen gegen Ungleichheit in der Bildung. Das Zentrum für Bildungsökonomik des ifo Instituts hat sein Bildungsbarometer in diesem Jahr dem Thema Bildungsungleichheit gewidmet. Mehr als 4.000 erwachsene Personen in Deutschland wurden nach ihren Einstellungen zu Chancengerechtigkeit und Bildungspolitik befragt.
Die Relevanz des Themas Bildungsungleichheit ist seit Jahren immer wieder herausgestellt worden: »Deutschland wird immer wieder dafür kritisiert, dass der Bildungserfolg von Kindern hier besonders stark von der sozialen Herkunft ihrer Eltern abhängig ist. Das belegte unter anderem eine Sonderauswertung der Pisa-Studie … Demnach hatten 15-Jährige aus sozial benachteiligten Familien Lernrückstände von bis zu dreieinhalb Jahren gegenüber Gleichaltrigen mit privilegierten Eltern – bei vergleichbaren kognitiven Voraussetzungen. Weitere Studien zeigten, dass Kinder aus besser gestellten Familien 2,5-mal so oft eine Gymnasialempfehlung erhalten, die Studierendenquote ist unter Akademikerkindern fast dreimal so hoch wie unter Nicht-Akademikerkindern«, so Inga Barthels in ihrem Artikel Das denken Deutsche über Bildungsungleichheit, in dem sie über die Ergebnisse des neuen Bildungsbarometers berichtet.