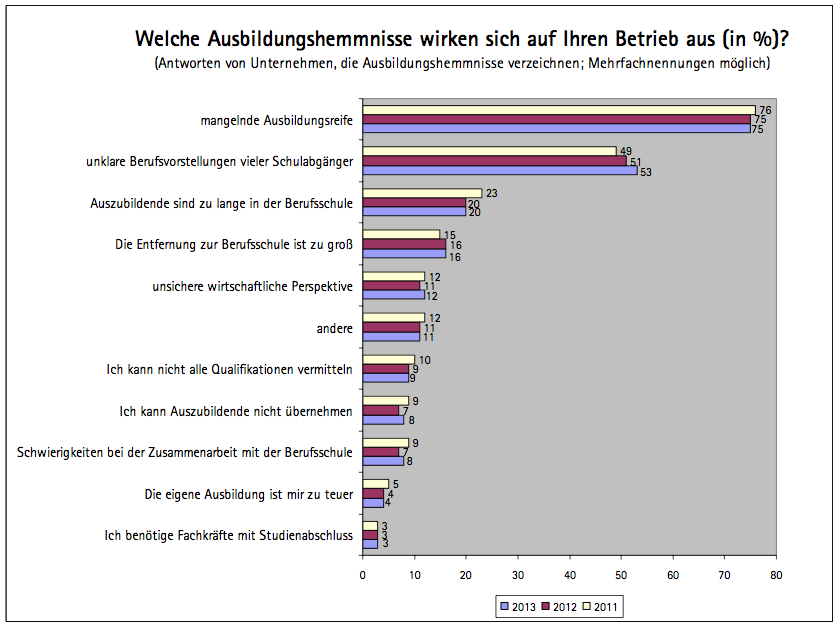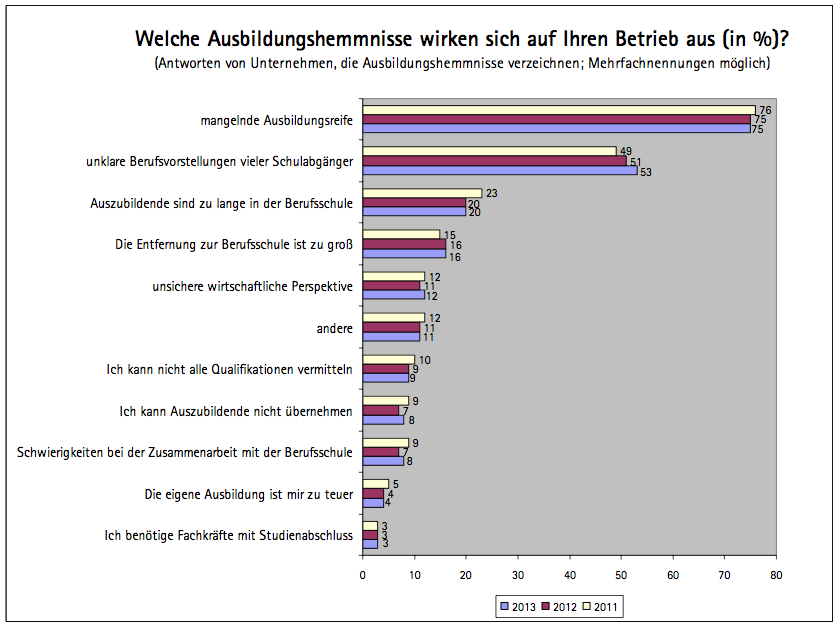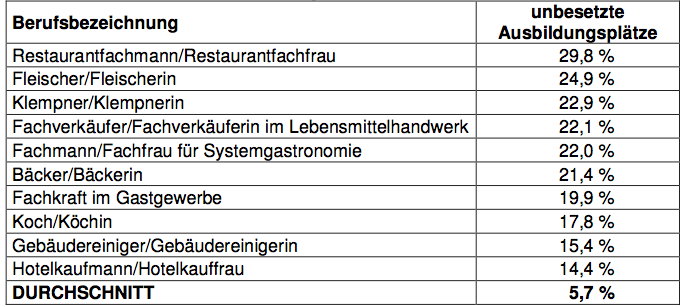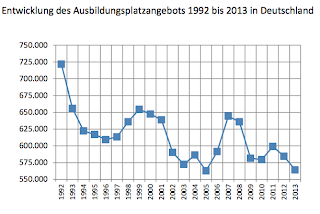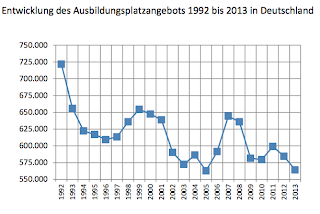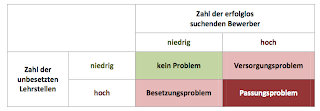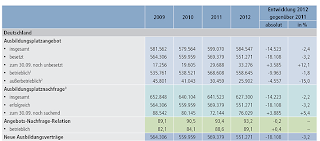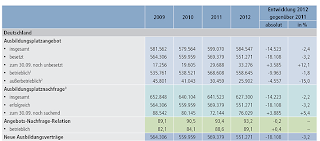Ein – allerdings nicht nur unter Experten reichlich umstrittenes – Megathema der Arbeitsmarkt- und Bildungsdiskussion ist „der“ Fachkräftemangel. Ein echtes Minenfeld, wenn man nicht genau und differenziert genug hinschaut. Aber immer noch reicht schon die Erwähnung des – angeblich – vorhandenen, im Entstehen begriffenen oder möglicherweise mittel- oder langfristig sich herausbildenden Fachkräftemangels, um Sorgenfalten auf die Stirn der Wirtschaft zu zeichnen und Politiker in Bewegung zu setzen. Zugleich bringt es die Debatte mit sich, dass man die komplexen Prozesse, die hier eine Rolle spielen, von der frühkindlichen Bildung über die Schulen und die Ausbildung bis hin zu Zuwanderung und Abwanderung, oftmals arg verkürzt oder gar ausblendet. Nicht zu vermeiden, aber gerade deshalb mit größter Sorgfalt zu behandeln ist die nationale Verengung auf den Nutzeraspekt „für uns“. Man kann das beispielhaft zeigen an der sehr doppelmoralig daherkommenden Debatte über Zuwanderer aus den EU-Ländern Rumänien und Bulgarien. Das ist die eine Seite dieser Zuwanderung, die der Armen, die im Mittelpunkt der Berichterstattung und damit auch der öffentlichen Wahrnehmung steht, sie ist in der Regel angst- und abwehrbesetzt. Über die vielen Ärzte aus diesen Ländern, die in den deutschen Krankenhäusern das Versorgungssystem gerade in vielen ländlichen Regionen Deutschlands aufrechterhalten, verliert man so gut wie kein Wort. Auch nicht über die Lücken, die diese Mediziner in ihren Heimatländern, die sie ausgebildet haben, hinterlassen. Die einen nutzen uns, die anderen belasten uns möglicherweise – letztendlich werden wir hier Zeuge einer krämerhaft wirkenden Kosten-Nutzen-Analyse von Menschen, die zum uns kommen.
Ein aktuelles Beispiel gefällig? »Wird das ganze Geld umsonst ausgegeben? Mehr als 300.000 Ausländer studieren derzeit an deutschen Unis. Doch dem deutschen Arbeitsmarkt nutzt dies am Ende herzlich wenig.« Überschrieben ist der Artikel, aus dem diese Sätze stammen, so: Ausländer gehen Arbeitsmarkt verloren. Da läuft doch was schief, werden viele mehr oder weniger bewusst denken, wenn sie das hören oder lesen. Aber schauen wir mal genauer hin.
Es geht um Ausländer, die zu uns nach Deutschland kommen, um hier zu studieren. »Zu viele brechen das Studium ab oder kehren nach erfolgreichem Abschluss in die Heimat zurück und gehen somit dem deutschen Arbeitsmarkt als Fachkräfte verloren.« Man bezieht sich dabei auf eine neue Ausgabe des vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft gemeinsam mit der Unternehmensberatung McKinsey herausgegebenen Hochschul-Bildungs-Reports 2020, der jährlich seit 2013 mit einem Vertiefungsthema erscheint. Diesmal war „Internationale Bildung“ dran. Da findet man beispielsweise diesen Hinweis: »Laut einer Umfrage von McKinsey und dem Stifterverband für den Hochschul-Bildungs-Report 2020 sind 50 Prozent der Unternehmen zur Deckung ihres Fachkräftebedarfs schon heute auf ausländische Absolventen angewiesen. 66 Prozent glauben, dass dies in Zukunft noch häufiger der Fall sein wird.« Die erwähnte Umfrage basiert auf einer Befragung von 230 Unternehmen in Deutschland. Gestützt wurde diese Befragung durch gut ein Dutzend Experteninterviews mit Personalverantwortlichen in MDAX- und DAX-Unternehmen. Jedes zweite Unternehmen? Na ja, vielleicht hat man da doch einen sehr engen Blick auf „die“ Unternehmen. Was für große Konzerne gilt, wird sich in den vielen anderen „normalen“ Unternehmen sicher anders darstellen. Aber diese Zweifel sollen hier gar nicht vertieft werden – sondern der kritische Blick ist auf die folgende Argumentation zu richten:
»In einen ausländischen Berufseinsteiger muss Deutschland deutlich mehr investieren als in einen inländischen Berufseinsteiger. Der Grund: Ausländische Studierende brechen deutlich häufiger ihr Studium ab als ihre deutschen Kommilitonen (41 Prozent versus 28 Prozent). Zudem kehren 54 Prozent der ausländischen Studierenden Deutschland nach ihrem Studium den Rücken – trotz des guten Arbeitsmarkts. Für einen deutschen Berufseinsteiger muss der Staat deshalb rund 45.500 Euro für die Hochschulausbildung aufwenden, für einen ausländischen Berufseinsteiger rund drei Mal so viel, nämlich 134.200 Euro. Der Fokus von Politik und Hochschulen sollte deshalb in den kommenden Jahren auf einer Senkung des Studienabbruchs, auf einer höheren Verbleibquote in Deutschland und auf einer langfristigen Finanzierung des Studiums von ausländischen Studierenden liegen.«
Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes lag die Zahl der ausländischen Studierenden im Wintersemester 2014/15 bei fast 320.000 – das ist mehr als eine Verdoppelung seit 1996. Den Statistikern zufolge gab es 2014 gut 107.000 ausländische Studienanfänger an deutschen Hochschulen, so viele wie nie zuvor. „Deutschland ist ein Bildungstransitland. Wir investieren viel Geld in ausländische Studierende, tun aber zu wenig, um diese erfolgreich zum Studienabschluss zu führen und sie zum Verbleib in Deutschland zu motivieren“, so wird der stellvertretende Generalsekretär des Stifterverbandes, Volker Meyer-Guckel, zitiert.
„Bildungstransitland“ – das ruft bei den älteren Semestern sicher Assoziationen hervor, beispielsweise der Transitverkehr durch die DDR, mit den böse blickenden Einreise-, Durchreise- und Ausreisebeamten des untergegangenen Arbeiter- und Bauernstaates, wenn man sich auf dem Landweg „durch die Zone“ nach Westberlin befand.
Aber wieder zurück zu den ausländischen Studierenden und den Kernaussagen des Hochschlug-Bildungs-Reports: Was ist an den zitierten Daten eigentlich so schlimm bzw. problematisch?
Die den Ausführungen mitlaufende Bewertung geht doch so: Da kommen (potenzielle) Fachkräfte, die das Arbeitsangebot hier bei uns erhöhen könnten, zum Studium nach Deutschland und dann müssen wir doch im Sinne einer bestechend einfachen Effizienzlogik, wenn wir schon Geld dafür aufwenden, so viel wie möglich „für uns“ aus dem Investment herausholen. Deshalb runter mit der Abbrecherquote und rauf mit der „Dableibe-Quote“, so die plausibel erscheinende Schlussfolgerung.
Hierzu nur zwei Anmerkungen:
1.) Wieso eigentlich runter mit der „Abbrecherquote“? Anders formuliert: Wenn man die Perspektive wechselt und davon ausgeht, dass der Maßstab nicht die den Industriestandards entsprechende, möglichst in Richtung 100 Prozent strebende, mithin hoch effiziente Ausnutzung des „Humankapitals“ ist, sondern die Anforderungen und Standards, die man einem Studium zuschreibt, die es zu erfüllen gilt, dann kann eine Verringerung der Abbrecherquote dann gerechtfertigt und sinnvoll sein, wenn sie auf einer schlechten Qualität der Lehre basiert und eine Verbesserung hier Menschen zum Abschluss führt, die eigentlich können, aber aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen nicht das schaffen, was sie schaffen könnten. Das mag einen Teil der Studierenden betreffen – aber es gibt eben auch einen je nach Studiengang nicht unerheblichen Teil an Studierenden, die schlichtweg den Anforderungen nicht gewachsen sind, was das Studium angeht, bei denen, wie die Ökonomen sagen würden, eine „Fehlallokation“ der Ausbildungsentscheidung vorliegt. Hier testiert der Abbruch lediglich ein Scheitern an den spezifischen Anforderungen des gewählten Studienprogramms. Würde man hier durch subtilen Druck oder explizite Anreize beispielsweise über Finanzierungsregelungen die Abbrecherquoten nach unten fahren, obgleich „eigentlich“ die Studierenden durchgefallen wären, dann hat das vor allem einen Effekt: Die Qualität des gesamten Systems würde sukzessive nach unten gefahren werden. Genau dieser (mögliche) Effekt wird doch generell in der Bildungsdiskussion immer wieder postuliert und heftig debattiert. Beispiel Schule: Wenn die Vorgabe lautet, dass die Schulen die Quote derjenigen, die ohne einen Schulabschluss die Schule verlassen, in den kommenden Jahren zu halbieren haben im Sinne der „Bildungsgerechtigkeit“, dann wird man sehen, dass diese Vorgabe statistisch auch realisiert wird. Das sagt aber erst einmal gar nichts darüber aus, wie man das erreicht hat. Nicht unplausibel und von den Beteiligten auch immer wieder bestätigt: Man senkt die zu überspringenden Hürden so weit ab, dass jeder rüber kommt.
- Die hier angesprochene grundsätzliche Problematik liegt letztendlich auch der folgenden Meldung aus dem Schulsystem zugrunde: So ungerecht sind Abiturnoten in Deutschland. Da erfahren wir: »So schlossen 2013 in Thüringen 38 Prozent aller Prüflinge mit einer Eins vor dem Komma ab; im angrenzenden Niedersachsen gelang das nicht mal halb so vielen Schülern, nämlich 16 Prozent. Auch die Durchfallerquoten unterscheiden sich stark: In Rheinland-Pfalz scheiterten nur 1,3 Prozent der Kandidaten, in Mecklenburg-Vorpommern fünfmal so viele … In Berlin lag der Anteil der Einserabiture 2013 sogar fast doppelt so hoch wie sieben Jahre zuvor.« Sind die jungen Menschen so unterschiedlich zwischen den Bundesländern? Der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Manfred Prenzel, wird mit diesen Worten zitiert: Bei der Benotung gebe es „Subkulturen“ in einzelnen Schulen und in den Bundesländern. „Die ostdeutschen Bundesländer haben eine ausgeprägte Tradition, Spitzenleistungen zu fördern und zu honorieren“, sagt Prenzel, „andere Länder neigen eher dazu, Abiturienten gleichzumachen, vielleicht aus politischen Gründen.“ Das Problem mit Blick auf den Zugang zu einem Studium: „Wenn die Schulnoten das alleinige Kriterium bei der Vergabe sind, kann dies dazu führen, dass die Schüler aus dem einen Bundesland bessere Karten haben als die aus dem anderen“, so Prenzel. Genau – und zwar möglicherweise unbeschadet der tatsächlichen Leistungsfähigkeit oder der kognitiven Stärke. Zugespitzt formuliert: Pech gehabt, wenn das Kind auf einer anspruchsvollen und strengen Schule war.
2.) Und wie ist es mit der Erhöhung der „Verbleibquote“? Das scheint doch vernünftig vor dem Hintergrund der Investition, die man in die ausländischen Studierenden getätigt hat. Dieser Ansatz folgt einer nationalen Binnenlogik, die aber nur die eine Seite der Medaille darstellt. Und es ist bezeichnend, dass selbst in einem Hochschlug-Report, an dem eine international aufgestellte Unternehmensberatung federführend beteiligt ist, eine Sichtweise vorangetrieben wird, die anscheinend immer noch von einer nationalökonomischen Verengung dergestalt gekennzeichnet ist, dass sie eine vordergründig verständliche Frage stellt: Nützen uns die was direkt? Also hier bei uns, in unseren Unternehmen? Letztendlich steht dahinter ein Modell, das man auch in nachfolgenden Verpflichtungen findet, wenn jemanden die Ausbildung teil- oder vollfinanziert wird und derjenigen sich verpflichten muss, dann x Jahre mindestens in dem Unternehmen zu arbeiten. Kauf dir eine ausländische Fachkraft in spe und du bekommst eine Rendite auf das eingesetzte Kapital.
Aber was ist denn wirklich so schlimm daran, wenn die, die hier studiert und gelebt haben, wieder zurück gehen in ihre Heimatländer? Eine kurze Illustration, warum das – möglicherweise – weitaus „gewinnbringender“ sein kann als die ausländischen Absolventen nach ihrem Studium hier in irgendein deutsches Unternehmen zu platzieren. An vielen Universitäten mit ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen wurden in den 70er, 80er und 90er Jahren bis heute ausländische Studierende „auf unsere Kosten“ ausgebildet, die dann in ihre Heimatländer zurück gegangen sind. Aber wenn man sich anschaut, wie viele dieser ehemaligen Studierenden, die ein paar Jahre in Deutschland gelebt und in der Regel auch sehr persönliche Erfahrungen hier haben machen können, heute in entscheidenden Positionen sitzen am anderen Ende der Welt, dann braucht man nicht viel Phantasie und kaum eine Studie, um nachzuvollziehen, dass nicht wenige Aufträge für deutsche Unternehmen aus dieser personalen Beziehung zu Deutschland generiert worden sind und tagtäglich entstehen. Das wäre eine volkswirtschaftliche Perspektive.
Man kann und muss diesen Gedankengang erweitern – beispielsweise auf die aktuelle Debatte über den Umgang mit den vielen Flüchtlingen, die zu uns kommen und unter denen auch viele sind, die eigentlich kein Asyl bekommen werden (können), die zurück müssten und irgendwann auch zurück gehen werden. Die aber oftmals jahrelang in der Duldungsschleife hängen. Nun kann man restriktiv verfahren wie bislang und die, die nicht aufrücken in den Status eines anerkannten Flüchtlings mit einem Bleiberecht, vom Arbeitsmarkt- und Ausbildungszugang fernzuhalten versuchen, denn da „lohnt“ sich eine Investition doch nicht und darüber hinaus würden hier möglicherweise Anreize gesetzt, dass noch mehr „verlorene“ Fälle kommen. Man könnte aber auch anders an die Sache herangehen und den Ansatz verfolgen, so schnell wie möglich auch in die zu investieren, die nicht auf Dauer hier bleiben werden. Zugang zu Arbeit und gerade bei den jüngeren Flüchtlingen zu einer Ausbildung so schnell wie möglich.
Aber es bleibt natürlich wie immer die Frage nach der Finanzierung. Denn die Attraktivitätszunahme eines Studiums in Deutschland, die sich in den ansteigenden Zahlen der ausländischen Studierenden niederschlägt, hat natürlich auch damit zu tun, dass anders als in so gut wie allen anderen Ländern in Deutschland keine Studiengebühren (mehr) erhoben werden. Nach dem Ausflug der meisten Bundesländer in die Welt der Studiengebühren wurde mittlerweile überall der mehr oder weniger geordnete Rückzug angetreten. Insofern müssen die Hochschulen jetzt wieder vollständig aus Steuermitteln finanziert werden. Hier gibt es jetzt einen Link zu dem Thema ausländische Studierende. Denn die Befürworter von Studiengebühren haben den Ausstieg auf der Erhebung von Studiengebühren nicht verwunden und benutzen die Berichte über die steigende Zahl an ausländischen Studierenden in Deutschland für einen Reanimationsversuch die Gebührenerhebung betreffend. So beispielsweise Katja M. Fels, Christoph M. Schmidt und Mathias G. Sinning in einem Gastbeitrag in der FAZ: Für sozialverträgliche Studiengebühren: Sogar aus Amerika kommen mittlerweile gerne Studenten nach Deutschland – weil das Studium hier kostenlos ist. Doch an deutschen Hochschulen fehlt das Geld. Deshalb gehört das Thema Studiengebühren wieder auf den Tisch. Sie plädieren dafür, »über ein sozialverträglich ausgestaltetes Gebührenmodell zu diskutieren und von anderen Ländern zu lernen« angesichts des erheblichen Mittelbedarfs der Hochschulen und politischer Rahmenbedingungen wie der Schuldenbremse, die dem Hauptfinanzier der Hochschulen, also die Bundesländer, die letzten Spielräume nehmen wird und den Zustand der gravierenden Unterfinanzierung der Hochschulen perpetuieren und vertiefen wird.
Aber sie nennen nicht nur die Finanznot der Hochschulen, sondern beziehen sich – sozialpolitisch hoch relevant – auf ein zweites Hauptargument für ein kostenpflichtiges Studium: Aspekte der „sozialen Gerechtigkeit“ würden dafür sprechen. Das irritiert erst einmal den einen oder anderen. Ihre Argumentation ist eine Zusammenfassung grundlegender Aussagen aus der Bildungsökonomie, also nichts Neues und sie geht so:
»Die Bildungsfinanzierung in Deutschland steht praktisch auf dem Kopf: Der private Kostenanteil bei frühkindlicher Bildung ist höher als die Kostenbeteiligung im Tertiärbereich. Anders ausgedrückt: Eltern müssen pro Jahr für einen Kita-Platz anteilig mehr aus der eigenen Tasche bezahlen als für das spätere Bachelorstudium ihres Nachwuchses … Diese Gewichtung öffentlicher und privater Investitionen im deutschen Bildungssystem steht den gesellschaftlichen Erträgen aus den jeweiligen Bildungsstufen diametral gegenüber. Während die durch internationale Studien belegten positiven gesellschaftlichen Folgen einer frühkindlichen Bildung besonders hoch sind, nicht zuletzt, weil der Zeithorizont, über den diese Bildungsinvestitionen Erträge abwerfen können, noch lang ist, weisen die deutlichen Einkommensunterschiede zwischen Akademikern und Nichtakademikern auf hohe private Erträge von tertiärer Bildung hin. Studierende profitieren also später selbst in hohem Maße von einem abgeschlossenen Studium – die zusätzlichen Gewinne für die Gesellschaft fallen im Vergleich zu denen früherer Ausbildungsphasen hingegen geringer aus.«
Aber die Autoren wissen um die verlorene erste Schlacht um Studiengebühren und postulieren deshalb: Ohne ein Modell, das Studiengebühren und Sozialverträglichkeit erfolgreich kombiniert, wird es keine (neue) Bewegung in dieser Frage geben.
Für die Entwicklung eines sozialverträglich ausgestalteten Studiengebührenmodells in Deutschland sehen die Autoren ein besonders relevantes Vorbild: Australien, denn diesem Land sei ein solches mit nachgelagerten Studiengebühren und dem „Higher Education Contribution Scheme“ (HECS) gelungen. Entwickelt wurde HECS von Bruce Chapman, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Australian National University in Canberra. Dieses Beitragsmodell sieht vor, dass Studiengebühren mittels eines staatlichen Kredits vorfinanziert werden und die Rückzahlung erst nach Eintritt ins Berufsleben beginnt.
Das soziale Element von HECS besteht aus drei Komponenten:
- Erstens wird dieser Kredit zinslos gewährt,
- zweitens greift die Verpflichtung zur Rückerstattung der Studiengebühren erst dann, wenn die Einkünfte des Schuldners eine festgelegte Schwelle überschreiten,
- und drittens erfolgt die Rückzahlung in einkommensabhängigen Raten; diese drei Komponenten unterscheiden HECS etwa vom amerikanischen oder britischen Gebührenmodell.
Eine sofortige und komplette Entrichtung der Studiengebühren vor Beginn des jeweiligen Studienjahres wird mit einem Nachlass von 20 % honoriert. »Die jährlichen Verwaltungskosten des Systems sind mit weniger als 3 Prozent der Einnahmen sehr gering, da die Rückforderung des Darlehens über das australische Finanzamt erfolgt. Dieses berechnet zusätzlich zur Einkommensteuer die Kredittilgungsraten und zieht sie direkt vom Steuerzahler ein. Ein verwaltungstechnisch aufwendiger und somit teurer Umweg über eine staatliche Förderbank, wie er bei der Einführung von Studiengebühren in Deutschland beschritten wurde, ist daher offensichtlich nicht notwendig«, so Fels/Schmidt/Sinning in ihrem Gastbeitrag für die FAZ.
Das alles klingt sympathisch – das australische Studienfinanzierungsmodell macht die Studienfinanzierung elternunabhängig und koppelt sie ans zukünftige Einkommen. Nur wer einen finanziellen Vorteil aus seinem Studium zieht, muss am Ende auch zahlen.
Aber das Wasser für den Wein ist nicht weit – das ist eine alte Diskussion, denn über das australische Modell wurde auch in Deutschland schon vor Jahren intensiv diskutiert, bevor die erste Welle der deutschen Studiengebühren über viele Bundesländer kam. Vgl. dazu nur als ein Beispiel den 2004 veröffentlichten Artikel Erst lernen, dann zahlen von Jan-Martin Wiarda. Bereits in diesem Artikel wird der Urheber des australischen Modells mit einer kritischen Bewertung zitiert: „Es ist wahr, die eingenommenen Studiengebühren sind nicht direkt an die Universitäten geflossen. Die Regierung hat sie genutzt, um ihren eigenen Beitrag zu verringern.“ Und Wiarda erläutert:
»Und der Rückzug der Politik war drastisch: Anfangs deckten die Studiengebühren in Australien gerade 10 Prozent der Universitätsbudgets; inzwischen hat die Regierung den Gebührenanteil auf fast 40 Prozent hochgeschraubt und ihre Zuschüsse zurückgefahren. Zwar ist die Zahl der australischen Studenten seit den Achtzigern tatsächlich auf mehr als das Doppelte gestiegen, wie die Regierung anführt, doch hat sich das Zahlenverhältnis zwischen Studenten und Lehrenden verschlechtert, und die Ausgaben pro Student sind real gesunken.«
Wohlgemerkt, 2004.
Und außerdem: Die Zunahme der ausländischen Studierenden kann man – jedenfalls aus Sicht Australiens – nicht als Argument für die Finanzierung über Studiengebühren nach dem durchaus in seinen Grundelementen sozialverträglichen Modell heranziehen: Das Modell kann als Inländer-Modell funktionieren, eignet sich aber nicht als Modell für die Behandlung von ausländischen Studierenden. Und selbst die inländischen Studierenden, die dann nach ihrem Studium ins Ausland gehen, erweisen sich im australischen System als Problem, denn die große Zahl von Australiern, die ihrem Heimatland nach Abschluss des Studiums den Rücken kehren, um in den USA oder in Großbritannien zu arbeiten, sind von der Rückzahlungspflicht ausgenommen.
Was bleibt ist die Frage, wie wir auf Dauer und nachhaltig die offensichtlich als Ausbildungsstätten immer wichtiger werdenden Hochschulen in Deutschland vernünftig finanzieren können. Und vernünftig meint hier etwas Doppeltes: Zum einen quantitativ ausreichend und zum anderen aber auch unter Berücksichtigung von Verteilungs- und damit immer auch Gerechtigkeitsfragen. Denn die derzeitige Finanzierung über Steuermittel kann vor dem Hintergrund der gegebenen Steuerstruktur in Deutschland durchaus als verteilungspolitisch sehr problematisch angesehen werden.