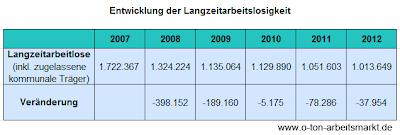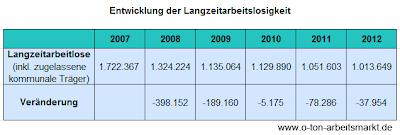Wenn wir über Steuern reden, dann sprechen wir von staatspolitisch und emotional fundamentalen Fragen – im wahrsten Sinne des Wortes handelt es sich um ein Minenfeld, auf dem nicht nur rational-materielle Interessen wirken, sondern hier werden Verteilungskämpfe ausgefochten und im übrigen kann man es in aller Regel keinem Recht machen. Die einen meinen, sie zahlen zu viel, die anderen meinen wiederum, die anderen, also nicht sie, zahlen zu wenig und sollten doch mehr zahlen.
Ein besonderer Zankapfel in Deutschland ist das Splitting in der Einkommenssteuer und hierbei das an die Institution Ehe gebundene Ehegattensplitting. Bei gemeinsamer Veranlagung wird das gesamte zu versteuernde Einkommen der beiden Ehepartner halbiert, die darauf entfallende Einkommensteuer berechnet und die Steuerschuld anschließend verdoppelt. Es wird also immer so getan, als ob beide Partner genau die Hälfte des gemeinsamen Einkommens verdienen würden. Dadurch ist die Steuerschuld des Ehepaares von der tatsächlichen Verteilung der Einkommen auf beide Partner unabhängig. Die ursprüngliche Begründung für dieses Vorgehen war die Annahme, dass Ehe = Kinder und einer in der Ehe, also die Frau, kümmert sich um die Kinder und geht keiner Erwerbsarbeit nach, so dass man über das Ehegattensplitting die Familien entlastet, denn sie zahlen ja weniger Steuern.
Nun wird seit langem am Institut des Ehegattensplitting herumgemäkelt, denn aufgrund der Bindung nur an den Tatbestand der Ehe kommt es natürlich auch zur Anwendung, wenn keine Kinder da sind. Illustriert wird das dann immer wieder gerne am Beispiel des sehr gut verdienenden Mannes und der nicht erwerbstätigen Ehefrau, die vom vollen Splittingvorteil profitieren können, obgleich keine Kinder vorhanden sind – während beispielsweise zwei nicht miteinander verheiratete Menschen, auch wenn dort drei oder mehr gemeinsame Kinder sind, überhaupt nicht vom Ehegattensplitting berührt werden, sie sind ja auch nicht miteinander verheiratet. Durch die Einführung der „Reichensteuer“ im Jahr 2007 ist der maximale Splittingvorteil für Ehepaare mit einem zu versteuernden Einkommen von über 250.000 Euro weiter gestiegen und erreicht für Einkommen von über 500.000 Euro jetzt ein Maximum von etwa 15.000 Euro pro Jahr.
Vor diesem Hintergrund gibt es zwei grundsätzliche Kritiklinien gegen das Ehegattensplitting, die immer wieder vorgetragen werden:
- Das Ehegattensplitting sei antiquiert, weil es (nur) auf das (formale) Institut der Ehe abstellt und hinsichtlich seiner spezifischen Anreizarchitektur – der Splittingvorteil nimmt rasch ab, wenn der andere Ehepartner zunehmend zum Haushaltseinkommen beiträgt, und er verschwindet, wenn beide Ehepartner das gleiche Einkommen erzielen – die Nicht- oder Niedrigst-Erwerbstätigkeit eines der beiden Partner, im Regelfall die Frau, massiv fördert.
- Die zweite Kritiklinie bezieht sich auf den (immer wieder behaupteten) „eigentlichen“ Zweck des Ehegattensplittings, darüber Familien mit Kindern, die durch die Nicht-Erwerbstätigkeit eines der Ehepartner, der sich um die Kinder kümmert, Einkommensausfälle haben, wenigstens partiell über die niedrigere Besteuerung des Paares zu entlasten. Innerhalb dieses Begründungszusammenhangs gibt es dann noch die Kritik, dass das Ehegattensplitting ungerecht sei, wenn Paare nicht in den Genuss der Entlastung kommen , obwohl sie Kinder haben, nur weil sie nicht miteinander verheiratet sind.
- Es gibt noch eine dritte Kritiklinie, die hier aber nicht geteilt wird, die aber in der aktuellen Debatte eine Rolle spielt: Die Entlastung sei um so größer, je höher die Einkommen sind. Das nun ist richtig, entspringt aber der inneren Logik einer Steuerentlastung, denn die hohen Einkommen zahlen ja auch höhere Steuern. Und das die unteren Einkommensgruppen, die oftmals gar keine oder nur sehr niedrige Steuern zahlen, dann gar nicht oder nur marginal von einer Steuerentlastung profitieren können, ist nun keine böse Absicht, sondern leitet sich aus der Besteuerungslogik an sich ab.
So weit die Vorrede, denn das Thema Splitting im Steuerrecht hat insofern den Wahlkampf erreicht, da die Unionsparteien – aber auch die FDP – mit der Forderung nach einem „Familiensplitting“ auftreten – einer Forderung, die für viele Beobachter des Geschehens zunächst durchaus nachvollziehbar daherkommt. Konkret: CDU/CSU schlagen vor, den Kinderfreibetrag auf die Höhe des Grundfreibetrags für Erwachsene anzuheben, was natürlich, weil an die Kinder gebunden, eine zusätzliche Entlastung der (verheirateten) Familien mit einem oder gar mehreren Kindern bedeuten würde, denn der derzeitige Kinderfreibetrag (7.008 Euro im Jahr) liegt unter dem für die Erwachsenen (demnächst 8.354 Euro). Natürlich weiß die Union um die Problematik, dass viele Familien im unteren Einkommensbereich gar keine oder nur sehr wenig Steuern zahlen, so dass bei ihnen keine Entlastung ankommen kann. Auch für diese Gruppe haben CDU/CSU (nicht aber die FDP) was im Gepäck, denn das Kindergeld soll um 35 Euro pro Monat erhöht werden – und das Kindergeld bekommen ja auch die Familien, die gar keine Steuern zahlen müssen, weil sie so wenig verdienen, also fast alle Familien, außer den „Hartz IV“-Familien, denn bei denen wird nach der bestehenden Rechtslage das gesamte Kindergeld auf den Grundsicherungsanspruch angerechnet, sie gehen also bei einer Erhöhung des Kindergeldes leer aus. Und schon sind wir mittendrin in einer Auseinandersetzung über das Familiensplitting.
Die Süddeutsche Zeitung berichtet unter der Überschrift „Schlechte Noten fürs Familiensplitting“ über eine massive Kritik des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin an den Plänen der Union, auch andere Medien sind auf den Zug aufgesprungen, beispielsweise Spiegel Online mit dem Artikel „Familiensplitting der Union kostet Steuerzahler Milliarden„. Claus Hulverscheidt fasst die zentralen Kritikpunkte der Ökonomen an dem Familiensplitting-Modell so zusammen: »Das Konzept der Union koste Milliarden, bevorzuge Gut- und Spitzenverdiener und halte Frauen davon ab, nach der Geburt eines Kindes in den Job zurückzukehren«.
Wer die Ausführungen des DIW im Original lesen möchte, der kann den Beitrag im neuen DIW Wochenbericht hier als PDF-Datei abrufen:
Richard Ochmann und Katharina Wrohlich: Familiensplitting der CDU/CSU: Hohe Kosten bei geringer Entlastung für einkommensschwache Familien. In: DIW Wochenbericht, Nr. 36/2013, S. 3-11
Das DIW hat das Familiensplitting-Modell der Union in ihrem Wahlprogramm mit den beiden bereits skizzierten Komponenten Erhöhung des Kindergeldes und Anhebung der Kinderfreibeträge auf das Niveau der Erwachsenen untersucht und kommt zu folgendem Ergebnis: Dieses Familiensplitting-Modell
»würde nach Berechnung des DIW Berlin Familien mit Kindern durchschnittlich um rund 700 Euro pro Jahr entlasten. Die Entlastung steigt mit dem Einkommen. Im untersten Zehntel (Dezil) der Einkommensverteilung beträgt die durchschnittliche Entlastung der Familien knapp 300 Euro pro Jahr, während sie im obersten Zehntel rund 840 Euro ausmacht. Familien mit geringen Einkommen werden also unterdurchschnittlich entlastet. Insgesamt kostet die Reform mehr als sieben Milliarden Euro pro Jahr.«
Damit man die vom DIW errechneten Kosten von zusätzlich 7 Mrd. Euro (Kinderfreibetrag und Kindergeld kosten die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden derzeit etwa 40 Milliarden Euro im Jahr) einordnen kann: »Das wäre fast die Hälfte dessen, was der Staat heute für die Subventionierung von Kindertagesstätten ausgibt«, so Hulverscheidt in seinem Artikel. Und zwar für alle Kindertageseinrichtungen (sowie der öffentlichen Förderung der Kindertagespflege) in Deutschland.
Die Idee für ein Familiensplitting stammt übrigens aus Frankreich, wo die Finanzämter das Familieneinkommen rein rechnerisch nicht nur auf die Ehepartner, sondern auch auf die Kinder verteilen. Dadurch sinkt für die Familie insgesamt die Steuerlast. Immer wieder wird man in der familienpolitischen Diskussion konfrontiert mit der Aussage, in Frankreich sei das besser geregelt für die Familien, denn die werden dort über die kindbezogene Entlastung besser gestellt als bei uns in Deutschland. Aber auch hier lohnt es sich wie so oft, genauer hinzuschauen:
Das DIW hat sich vor diesem Hintergrund erneut mit dem französischen Modell auseinandergesetzt und dieses sowohl mit dem bestehenden deutschen System wie auch mit den Vorschlägen der Union hinsichtlich einer Weiterentwicklung des Ehegatten- zu einem Familiensplitting beschäftigt. Die Ergebnisse sind ernüchternd. So schreiben die Forscher in ihrer Zusammenfassung:
»Es zeigt sich, dass schon das bestehende deutsche Modell in weiten Teilen großzügiger ist als das französische. Die finanziellen Vorteile für deutsche Familien würden sich bei Umsetzung der Unionspläne vergrößern.«
Das sind nun alles keine neuen Befunde, denn das DIW hat schon in der Vergangenheit sowohl die Forderung nach einem Familiensplitting wie auch die Behauptung, die Franzosen stehen besser da, kritisch unter die Lupe genommen – verwiesen sei an dieser Stelle nur auf die Pressemitteilung des DIW vom 06.03.2013: „Französisches Familiensplitting taugt nur bedingt als Vorbild„. Bereits damals wurde herausgearbeitet, dass die Einführung des französischen Modells in Deutschland nur geringe Veränderungen zur Folge hätte: »Nur Familien mit drei oder mehr Kindern würden stärker entlastet, da in Frankreich die steuerliche Förderung des dritten Kindes doppelt so hoch ausfällt wie die für das zweite Kind. Die gleichen Wirkungen könnten in Deutschland jedoch mit einer Verdoppelung des Kinderfreibetrages für das dritte Kind erreicht werden.«
Und auch schon damals wurde auf einen allerdings wichtigen Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland hingewiesen:
»Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem deutschen und dem französischen System betrifft den Familienstand: Französische Paare mit oder ohne Kinder müssen im Unterschied zu deutschen Paaren nicht verheiratet sein, um vom Familiensplitting zu profitieren – es reicht, wenn sie den PACS (pacte civil de solidarité) eingegangen sind. Dies ist in Frankreich auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich.«
Während mittlerweile – vor allem durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – die Benachteiligung der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften abgebaut worden ist, bestehen aus der Perspektive einer primär am Tatbestand der angestrebten Entlastung von Familien mit Kindern zwei zentrale Verwerfungen, die im Unionskonzept perpetuiert werden:
- Die steuerliche Entlastung ist weiterhin – weil in der Systematik des Ehegattensplitting bleibend – geknüpft an den Tatbestand, dass hier verheiratete Paare entlastet werden (und mittlerweile auch gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften) – aber eben nicht unverheiratete Paare mit Kindern.
- Nicht nur sozialpolitisch fragwürdig ist die Exklusion der vielen Familien im „Hartz IV“-Bezug, denn die können natürlich nicht von der steuerlichen Entlastung profitieren, kommen aber auch noch nicht einmal in den Genuss des erhöhten Kindergeldes, denn das wird vollständig angerechnet auf ihren Grundsicherungsanspruch. Hier wird also der beklagenswerte Tatbestand einer Zwei-Klassen-Gesellschaft an Familien fortgeschrieben und verfestigt.
Fazit: Vor dem Hintergrund des enormen finanziellen Aufwandes in Höhe von geschätzt 7 Mrd. Euro für die Umsetzung des Familiensplitting-Modells (man sollte eigentlich korrekter von einem „Verheirateten-Familiensplitting-Modell sprechen) kann man die Schlussfolgerung der DIW-Ökonomen durchaus nachvollziehen: »Angesichts der hohen fiskalischen Kosten des Unionsvorschlags sollte deswegen in Erwägung gezogen werden, die Mittel eher in Maßnahmen zu investieren, die einen solchen Zielkonflikt nicht aufweisen, wie zum Beispiel den Ausbau qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung«, schreiben Ochmann und Wrohlich in ihrer Zusammenfassung.
Man muss sich nur mal vorstellen, welche erheblichen Verbesserungen wir in der so wichtigen Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur für Kinder erreichen könnten, wenn wir sieben Milliarden Euro zusätzlich investieren könnten. Aber auch wenn wir im Themenfeld Entlastung der Familien mit Kindern (und hier völlig unabhängig von der Frage, ob verheiratet oder nicht) bleiben und nach Alternativen suchen, dann lohnt ein Blick auf das Konzept einer „Kindergrundsicherung“, das von einem breiten Bündnis vertreten wird. Weiterführende Informationen zu diesem Ansatz gibt es auf der Website www.kinderarmut-hat-folgen.de.