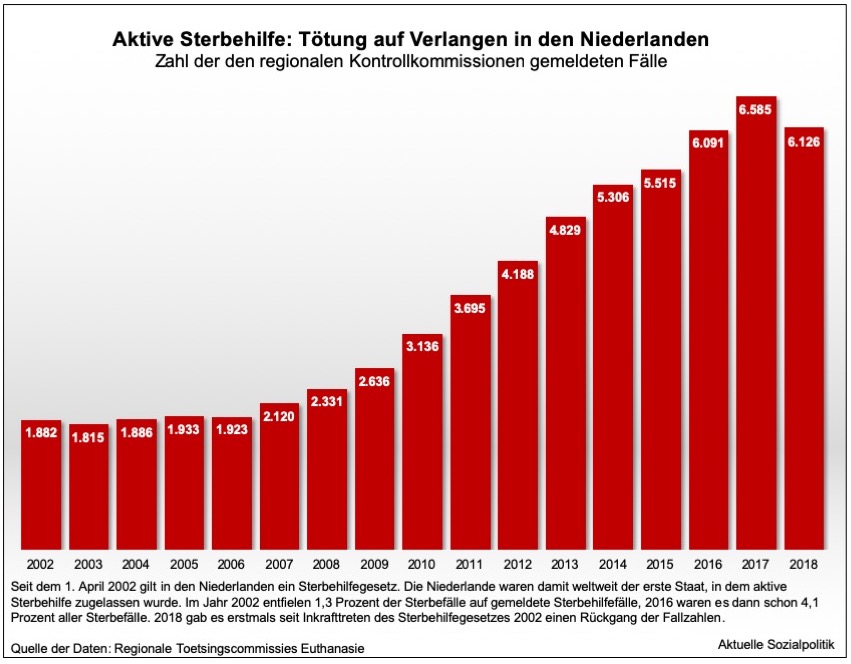»Im Jahr 2015 starben … in den Niederlanden 109 Demenzpatienten durch Sterbehilfe. 2016 stieg die Zahl auf 141. Doch darf man einen Demenzkranken im fortgeschrittenen Stadium töten, nur weil er vor Jahren eine Verfügung erstellt hat?«, so die Frage von Merle Schmalenbach in ihrem Artikel Die Lebensmüden. »Längst ist die aktive Sterbehilfe dort nicht nur Menschen vorbehalten, die terminal krank sind. Auch jedes nicht tödliche Leiden kann sofort beendet werden. Es muss nur als unerträglich diagnostiziert werden. Demenzkranke lassen sich töten, Depressive, Menschen mit Borderline-Störung, Behinderte.« Das könne man den Berichten der Regionalen Kommissionen zur Sterbehilfe-Kontrolle entnehmen.
Und dann dieser Sachverhalt, über den in diesem Artikel berichtet wurde: „Sterbehilfe“-Prozess startet in Holland: »Am 22. April 2016 hat die beklagte Ärztin eine damals 74-jährige demenzkranke Frau mutmaßlich auf ihren Willen hin getötet … Beim vorliegenden Fall soll die Ärztin indes gegen ihre Sorgfaltspflichten verstoßen haben. Zunächst hatte die Patientin in einer schriftlichen Erklärung festgehalten, dass sie Sterbehilfe wünsche, wenn sie aufgrund ihrer fortschreitenden Demenz in ein Pflegeheim eingewiesen werden müsse. Nach der Aufnahme im Heim gab die Patienten indes „gemischte Signale über ihren Todeswunsch“ ab. Dennoch wurde sie von der Ärztin getötet, nach Darstellung des Gerichts erfolgte dies im Einvernehmen mit der Familie der alten Dame.«
Über diesen Fall wurde hier bereits in dem Beitrag Aus den Zwischenwelten der Euthanasie: Tötung auf Verlangen – oder doch nicht? Ein Fall aus den Niederlanden und fundamentale Fragen darüber hinaus vom 21. September 2019 berichtet.