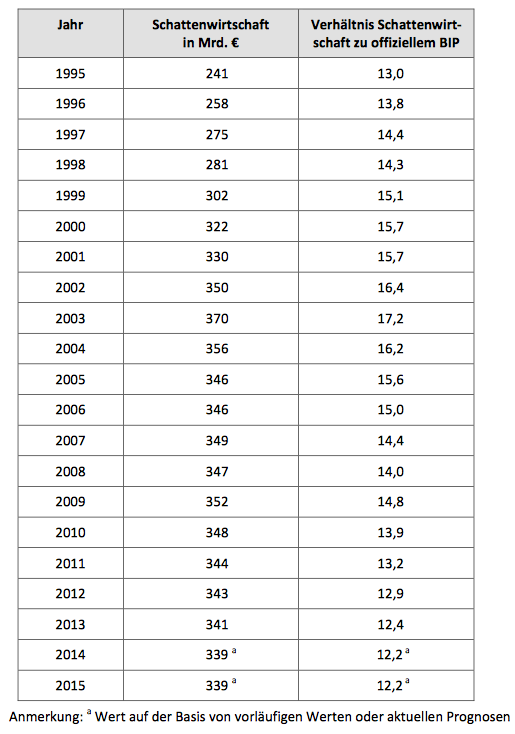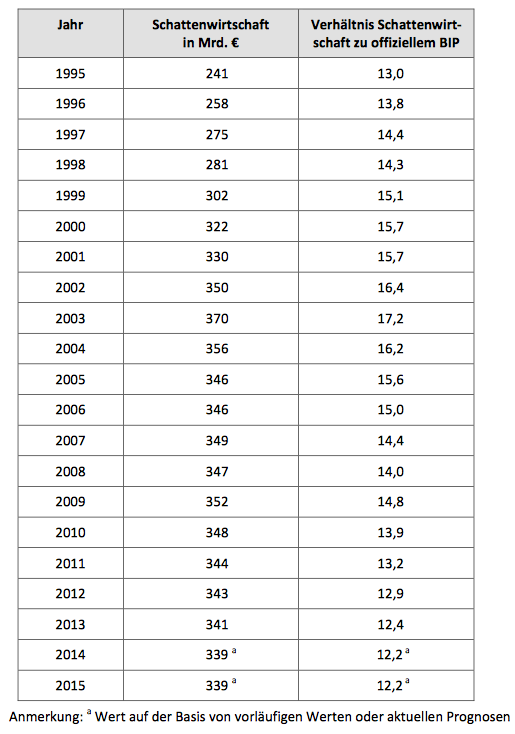In der neuen Print-Ausgabe des SPIEGEL (Heft 6/2015) wurde das Thema gesetzlicher Mindestlohn und seine Infragestellung ebenfalls aufgegriffen unter der bezeichnenden Überschrift „Irrfahrt der Lobbyisten“ (S. 60 ff.): »Um Punkte bei der eigenen Klientel zu machen, entfacht die Union eine Kampagne gegen das Mindestlohngesetz von Arbeitsministerin Andrea Nahles. Nur: Das angebliche Bürokratieproblem existiert in Wahrheit nicht.«
Neben anderen Klarstellungen geht der Artikel auch ein auf die Minijobber und entkräftet die „Bürokratiemonster“-Stimmung, die hier derzeit entfaltet wird:
»Privathaushalte sind ohnehin von der Zettelpflicht befreit, sie gilt nur für Unternehmen. Und ein Blick in die Vorgaben verrät, dass die Belastung sich in Wahrheit wenig verändert. Schon seit Jahren sind Arbeitgeber bei Minijobs per gemeinsame „Geringfügigkeits-Richtlinien“ der Sozialversicherungen und der Bundesagentur für Arbeit verpflichtet, in den „Entgeltunterlagen“ von Minijobbern neben dem monatlichen Salär und der Beschäftigungsdauer auch „die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit und die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden“ aufzuzeichnen.«
Und so ist man derzeit bemüht, auch mehr als skurrile Beispiele für die angeblich schädlichen Wirkungen des Mindestlohns ans Tageslicht zu zerren, vielleicht frei nach dem Motto, auch wenn das ausgemachter Unsinn ist, irgendwas wird schon hängen bleiben von der Message, der Mindestlohn ist schlecht. Ein Beispiel für dieses Genre ist der Artikel Wandergesellen und das Problem mit dem Mindestlohn von Thomas Walbröhl. Es geht um ein Bild, das bei vielen Menschen positive Gefühle wecken wird, weil es einen romantischen Nerv trifft: Handwerkergesellen, die auf die Walz gehen. Was für ein schönes Zucken aus der berufsständischen Vergangenheit. Da gibt es Handwerker, die als „Freireisende“ auf Walz gehen, während sich die meisten an den so genannten „Schächten“ gebunden haben, das sind Handwerkervereinigungen, die sich dafür einsetzen, das Brauchtum der Walz zu pflegen und den Kontakt mit den Gesellen zu halten. Ja nach Schacht kommen aus unserer heutigen Sicht mehr als denkwürdige Vorschriften für die zumeist dreijährige Wanderszeit hinzu: »Wer auf die Walz gehen will, muss zum Beispiel den Gesellenbrief in der Tasche haben, unverheiratet, schuldenfrei und jünger als 30 Jahre alt sein. Wandergesellen dürfen keine Kommunikationsgeräte mitnehmen, nur Papier und Stift. Laptop und Handy sind tabu. Für Kost und Logis darf der Reisende kein Geld ausgeben und sich seinem Heimatort nicht weiter als 50 Kilometer nähern.«
Natürlich empfindet man gerade in den heutigen Zeiten irgendwie Sympathie und Wohlwollen für die Menschen, die sich eine Zeit lang auf einen solchen Lebensweg einlassen. Eine bewahrenswerte Tradition, die allerdings die gleichen Probleme hat, wie viele andere Traditionen auch: Irgendwie fehlt es an Nachwuchs und die alte Bedeutung dessen, was man da tut, ist verlustig gegangen. Wir reden hier in Deutschland von 800 Bäcker, Zimmerer oder Dachdecker, die derzeit unterwegs sind. Nicht mehr, wenn auch jeder Einzelfall etwas ganz Besonderes ist.
Und um die wird nun eine weitere Mindestlohn-Baustelle eröffnet, die sich bei genauerem Hinsehen dann auch noch als ein Fake erweist. Walbröhl lässt in seinem Artikel die Funktionäre zu Wort kommen:
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) fürchtet, dass das soziale Netzwerk der Wandergesellen gefährdet ist. „Der Mindestlohn bedroht die Tradition der Walz“, hieß es im Dezember beim ZDH. Auch der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks zeigt sich besorgt. Die nach dem zweiten Weltkrieg größtenteils zum Erliegen gekommene Tradition lebe endlich wieder auf, heißt es beim Verband. „Die Walz ist gerade wieder ein zartes Pflänzchen, das wir mit unserer Initiative Bäckerwalz beleben wollen“, sagt Präsident Peter Becker. „Wir fürchten, dass mit dem Mindestlohn die Bereitschaft von Betrieben in manchen Gebieten sinkt, Gesellen überhaupt aufzunehmen.“
Das ist aber nicht gut – wenn es denn so wäre. Und der eine oder die andere wird an dieser Stelle bedenklich den Kopf wiegen und sich daran erinnern, dass wir hier von und über Handwerksgesellen sprechen, die eine ordentliche Berufsausbildung absolviert haben. Wo genau soll denn jetzt das Problem liegen? Der Artikel entlarvt die fragwürdige Argumentation der Berufsfunktionäre selbst am Beispiel des 23-jährigen Maurice, der als Bäckergeselle auf der Walz ist:
»Maurice hat bei seinen befristeten Tätigkeiten bisher immer nur nach jeweiligem Ortstarif gearbeitet, und der liegt für ausgelernte Bäcker höher als der Mindestlohn. „Das ist auch Verhandlungssache. Ich bin gut ausgebildet, eine Fachkraft. Ich würde nie unter dem ortsüblichen Tarif arbeiten. Dann würde ich eher weiterziehen.“ Auch bei den anderen Gesellen, die er kennengelernt habe, sei das nicht anders. „Das hat auch mit Solidarität zu tun.“ Bei sozialen Projekten wird ausnahmsweise auch mal nur für Kost, Logis und Krankenversicherung gearbeitet. Auf der letzten Sommerbaustelle zum Beispiel hat Maurice gemeinsam mit Gesellen anderer Zünfte für eine Kinder-Betreuungseinrichtung ein Haus hochgezogen.«
Und Kommentatoren weisen darauf hin, dass der von den Funktionären vorgebrachte Vorwurf, dass mit dem Mindestlohn die Bereitschaft von Betrieben in manchen Gebieten sinkt, Gesellen überhaupt aufzunehmen, angesichts der Tatsache, dass wir hier a) über 8,50 Euro pro Stunde reden und b) dass eine zeitweilige Beschäftigung eines Handwerksgesellens für viele Handwerksunternehmen eine attraktive Sache ist, eine ziemlich verwegene These darstellt. Man kann es aber auch anders formulieren: Gerade die wenigen Handwerker, die noch auf die Walz gehen, sollten doch nun wirklich mehr wert sein als die 8,50 Euro pro Stunde, die man allen, auch un- und angelernten Arbeitnehmern gewährt bzw. jetzt gewähren muss.
Es ist derzeit aber auch ärgerlich – auf dem real existierenden Arbeitsmarkt sind die großen Wellen mindestlohneinführungsbedingter Arbeitslosigkeit bislang ausgeblieben, mit denen man die Bevölkerung in Angst und Schrecken hätte versetzen können. Aber die Akteuere geben nicht auf und nutzen allgemeine Bekundungen, dass der Mindestlohn schlecht sei, für ein allerdings höchst gefährliches und verwerfliches Unterfangen: CSU will „Monster“ Mindestlohn entschärfen, kann man beispielsweise einer Artikel-Überschrift entnehmen. In diesem Beitrag wird beispielsweise Gerda Hasselfeldt zitiert, die im Bundestag die CSU-Landesgruppenchefin ist:
»Wir müssen dringend nachjustieren, die Dokumentationspflichten reduzieren und praxistaugliche Lösungen finden. Bis Änderungen vorgenommen sind, sollten wir die Kontrollen des Mindestlohns durch den Zoll aussetzen.«
Das ist natürlich schon mehr als frech – der Staat soll sich gleichsam selbst entmannen und auf die Kontrolle der Einhaltung eines seiner Gesetze verzichten – was natürlich eine offene Einladung wäre an alle die Arbeitgeber, die sich bemühen, die neue, für alle Betriebe geltende Lohnuntergrenze durch Umgehungsstrategien zuungunsten der Arbeitnehmer zu unterlaufen. Würde der Staat seine eigenen, übrigens angesichts der vorhandenen Kapazitäten beim Zoll reichlich unterdimensionierten Kontrollaktivitäten auch noch einstellen, dann würde das den schwarzen Schafen unter den Arbeitgebern einen kräftigen Schub geben und zugleich die Arbeitgeber, die sich korrekt (oder sogar noch besser) verhalten gegenüber ihren Mitarbeitern, bestrafen und ihnen staatlich unterstützte Wettbewerbsnachteile gegenüber denen, die sich nicht an die Regeln halten, bescheren.
Hier werden ganz offensichtlich die falschen Schlachten geschlagen, um sich einen Sympathiepunkt bei den Verbänden und Unternehmen einzufangen. Trotzdem gibt es offensichtlich publizistische Schützenhilfe für diese Position – beispielsweise der Kommentar Mindestlohn funktioniert nur auf einsamen Inseln von Olaf Gersemann, der nur einen Moment beim Verfassen seiner Überschrift nach links der rechts hätte schauen müssen, um zu erkennen, dass das Bild mit der Insel Humbug ist, denn die meisten Länder um uns herum haben einen gesetzlichen Mindestlohn oder für alle verbindliche tarifliche Lohnuntergrenzen – insofern wird ein Schuh daraus, dass Deutschland bislang eine Insel war, die daraus Vorteile gezogen hat, beispielsweise Lohndumping gegenüber den Nachbarn. Man möge hierzu nur ein Blick werfen in die deutsche Fleischindustrie, die vor dem Hintergrund der Nicht-Existenz einer Lohnuntergrenze in der Vergangenheit zum europäischen Billigschlachthaus degeneriert ist mit der Folge, dass die europäischen Nachbarn mit ihren besseren Arbeitsbedingungen aus Konkurrenzgründen in die Knie gegangen sind.
Aber wie tief wir gesunken sind beim Umgang des Staates mit sich selbst, verdeutlich der folgende Bericht über Aussagen des Bundesfinanzministers Schäuble (CDU):
»Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) fordert, das für die Kontrolle des Mindestlohns notwendige Geld lieber in die Terrorabwehr zu stecken. „Wenn wir in Deutschland mehr Personal im Sicherheitsbereich brauchen, würde ich zum Beispiel darüber diskutieren, ob wir wirklich so viel Personal bei der Kontrolle eines im internationalen Vergleich sehr komplizierten Mindestlohns brauchen oder ob wir nicht sagen, andere Prioritäten wie die Polizei sind jetzt wichtiger“, sagte Schäuble der „Welt“.« Man muss sich einmal klar machen, welche Signale hier von der obersten Staatsspitze ausgesendet werden.
Dabei gibt es ganz andere Baustellen, über die man dringend offen sprechen sollte – gerade wenn man ein Befürworter des Mindestlohns ist:
Da ist beispielsweise der Bereich der sozialen Dienste, die natürlich auch vom Mindestlohn betroffen sind – die aber das Problem haben, dass sie teilweise oder auch vollständig refinanziert werden müssen aus öffentlichen Mitteln. Man kann das Dilemma deutlich machen an der neueren Rechtsprechung, was denn vom Mindestlohn – der ja bewusst konzipiert worden ist als ein Stundenlohn – umfasst wird. Ein strittiges Thema hierbei waren die Bereitschaftsdienste – und man möge an dieser stelle einmal kurz nachdenken darüber, wie viele soziale Dienstleistungen erbracht werden, bei denen man bisher einen Teil der Zeit als Bereitschaftsdienst ausgewiesen und entsprechend niedriger vergütet hat, was zugleich auch Grundlage der Refinanzierung aus den öffentlichen Kassen war und ist.
Zum Thema Bereitschaftsdienste wurde bereits 2013 in diesem Blog anlässlich eines Urteils des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg ausgeführt:
»Schon die Artikelüberschrift „Mindestlohn im Schlaf verdient“ des Arbeitsrechtlers Jobst-Hubertus Bauer ist Programm. Was ist das Problem? „Gehört Bereitschaftsdienst zur Arbeitszeit dazu? Ein Gericht entschied jetzt: ja. Damit bekommt eine Altenpflegerin 1000 Euro mehr Gehalt.“ Das hört sich doch erst einmal gut an, man freut sich für die ansonsten ja nun eher unterbezahlten Pflegekräfte – aber der Arbeitsrechtler Bauer ist ganz anderer Meinung: Der Gesetzgeber muss einschreiten, sonst wird Pflege unbezahlbar. Hintergrund ist eine neue Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg (LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 28. November 2012, Az. 4 Sa 48/12). Bauer beschreibt in seinem Artikel den Sachverhalt, der dem Urteil zugrunde liegt:
„Geklagt hatte eine Pflegehelferin, die von einem privaten Pflegedienst in sogenannten Rudu-Diensten („Rund um die Uhr“) zur Betreuung von zwei dementen Nonnen in einem katholischen Pflegeheim eingesetzt wurde. Vereinbart war ein Bruttomonatslohn von 1885,85 Euro. Die Einsätze erstreckten sich jeweils über zwei Wochen, danach hatte die Klägerin jeweils knapp zwei Wochen frei. Während der Dienste wohnte und schlief die Klägerin in dem Pflegeheim. Sie fand, die gesamte Zeit der Rudu-Dienste sei als Arbeitszeit zu werten, die mit dem Mindestlohn von damals 8,50 Euro zu vergüten sei. Pro vierzehntätiger Rudu-Schicht wäre demnach eine Vergütung von 24 x 14 x 8,50 Euro zu zahlen, also unterm Strich 2856 Euro. Der Arbeitgeber hielt dagegen, es habe erhebliche Zeiten ohne Arbeitsanfall gegeben. Schon rein physisch sei es nicht möglich, zwei Wochen am Stück durchzuarbeiten, weil die Klägerin zum Beispiel auch schlafen und essen muss. Das Landesarbeitsgericht gab aber der Klägerin überwiegend recht.“
Zwar hat das LAG eine Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen, aber Bauer geht davon aus, dass auch dort die Entscheidung des LAG bestätigt wird.«
Genau das ist zwischenzeitlich passiert. Im November 2014 wurde auf der Facebook-Seite von „Aktuelle Sozialpolitik“ berichtet:
Das Bundesarbeitsgericht hat … ein wichtiges Urteil verkündet zum Thema Mindestlohn in der Pflege: Der Mindestlohn in der Pflegebranche muss auch für Bereitschaftsdienste voll gezahlt werden … Der entscheidende Passus hinsichtlich der Entscheidung der obersten Arbeitsrichter, der sich zusammenfassen lässt mit „oben sticht unten“:
»Das Mindestentgelt nach § 2 PflegeArbbV ist „je Stunde“ festgelegt und knüpft damit an die vergütungspflichtige Arbeitszeit an. Dazu gehören nicht nur die Vollarbeit, sondern auch die Arbeitsbereitschaft und der Bereitschaftsdienst. Während beider muss sich der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort bereithalten, um im Bedarfsfalle unverzüglich die Arbeit aufzunehmen. Zwar kann dafür ein geringeres Entgelt als für Vollarbeit bestimmt werden. Von dieser Möglichkeit hat der Verordnungsgeber im Bereich der Pflege aber keinen Gebrauch gemacht. Deshalb sind arbeitsvertragliche Vereinbarungen, die für Bereitschaftsdienst in der Pflege ein geringeres als das Mindestentgelt nach § 2 PflegeArbbV vorsehen, unwirksam.«
Man kann das auf zahlreiche andere Fallkonstellationen übertragen, auf die man bei den sozialen Diensten trifft – man denke hier nur an die Jugendhilfe, an die Behindertenhilfe oder an die Wohnungslosenhilfe mit ihren stationären Einrichtungen. Das wäre alles kein Problem, wenn sich die Kostenträger – und das sind oftmals die Bundesländer – zu ihrer den Mindestlohn ermöglichenden Verantwortung bekennen würden und deshalb die Refinanzierung dieser Dienste auf das Niveau anheben, das erforderlich ist, damit die höheren Personalkosten auch wieder ausgeglichen werden können. Man muss keine prophetischen Gaben besitzen um vorherzusagen, dass wir in der kommenden Zeit zahlreiche Konflikte zwischen den Sonntagsreden pro Mindestlohn und dem tatsächlichen Verhalten der Kostenträger bei einer Anpassung der Refinanzierung der sozialen Dienste erleben werden. Kurzum: Wir werden in den kommenden Monaten genau beobachten müssen, was Bundesländer, die ansonsten auf der Verlautbarungsebene große Befürworter eines gesetzlichen Mindestlohns sind, praktisch tun werden, wenn wir z.B. in der Wohnungslosenhilfe erhebliche Kostensteigerungen haben im Zuge einer Umsetzung des BAG-Urteils. Wird dann das Bundesland hingehen und diese offensichtliche Lücke wieder schließen?
Und ein zweiter Aspekt: Immer und teilweise ausschließlich dreht sich die kritische Debatte über den Mindestlohn um die Fälle, in denen es angeblich oder auch tatsächlich nicht möglich ist, den Mindestlohn zu zahlen, weil man das betriebswirtschaftlich nicht darstellen kann (oder will). Es gibt aber auch eine andere, durchaus bedenkliche Entwicklungslinie: Der Mindestlohn als Referenzlohn nach unten. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es durchaus die Fälle gibt, in denen Unternehmen einen bislang höheren Lohn gezahlt haben, sich nun aber bei Neueinstellungen am niedrigeren Mindestlohn orientieren. Man schaue – um nur ein Beispiel zu nennen – einmal auf die Branche der beruflichen Weiterbildung, die einen branchenbezogenen Mindestlohn haben, der über den 8,50 Euro pro Stunde liegt. Dort konnte man die angedeutete Entwicklung bei einigen großen Trägern der beruflichen Weiterbildung beobachten mit der Konsequenz einer Zweiteilung der Belegschaften in die „Alt“- oder „Bestandsfälle“, die noch nach den besseren früheren Bedingungen vergütet werden und den „Neuen“, die deutlich abgesenkte Vergütungen bekommen, weil sich die Unternehmen hier an dem Branchenmindestlohn orientieren.
Fazit: Ungerechtfertigte Angriffe gegen den gesetzlichen Mindestlohn müssen abgewehrt werden, vor allem, wenn sie auf Unwahrheiten basieren. Daneben ist eine genau Beobachtung und Bewertung der realen Arbeitsmarktentwicklungen erforderlich, um an der einen oder anderen Stelle Korrekturen vornehmen zu können. Aber was machen viele der Anbieter von Leistungen, die sich überwiegend oder ausschließlich öffentlich finanzieren lassen müssen. Sie werden angewiesen sein auf eine „mindestlohnkonfrome“ Politik der Kostenträger. Mal sehen, ob das funktioniert oder aber ob nicht die Träger wieder auf sich selbst verwiesen werden, was natürlich dazu führen muss, dass es auch bei sozialen Dienstleistern zu Umgehungspraktiken kommen muss. Vielleicht aber auch zu einer offenen Debatte über das, was man leisten kann auf der Basis der refinanzierten Mittel. Und was nicht.