Am 9. Oktober 2025 hat die Bundesregierung mitgeteilt: »Die Vorsitzenden der Regierungsparteien haben sich im Koalitionsausschuss vor allem zu drei Themen verständigt: der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur, der Einführung der Aktivrente und der Grundsicherung.« Das Bürgergeld soll durch die neue Grundsicherung abgelöst werden, habe man „in einer wirklich guten Atmosphäre beschlossen“, so der Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Und dazu werden uns dann noch diese Hinweise gegeben: »Für Menschen, die arbeiten können, soll grundsätzlich der Vermittlungsvorrang gelten: Sie sollen schnellstmöglich in Arbeit gebracht werden. Außerdem gilt das Prinzip Fördern und Fordern: Wer nicht mitwirkt, muss mit schärferen Sanktionen rechnen.«
Da schauen wir doch mal in das Original, also in den Beschlusstext des Koalitionsausschusses, Stand: 09.10.2025, um zu prüfen, ob es etwas genauer geht. Die beiden letzten Seiten des Papiers stehen unter der Überschrift „Neue Grundsicherung“.
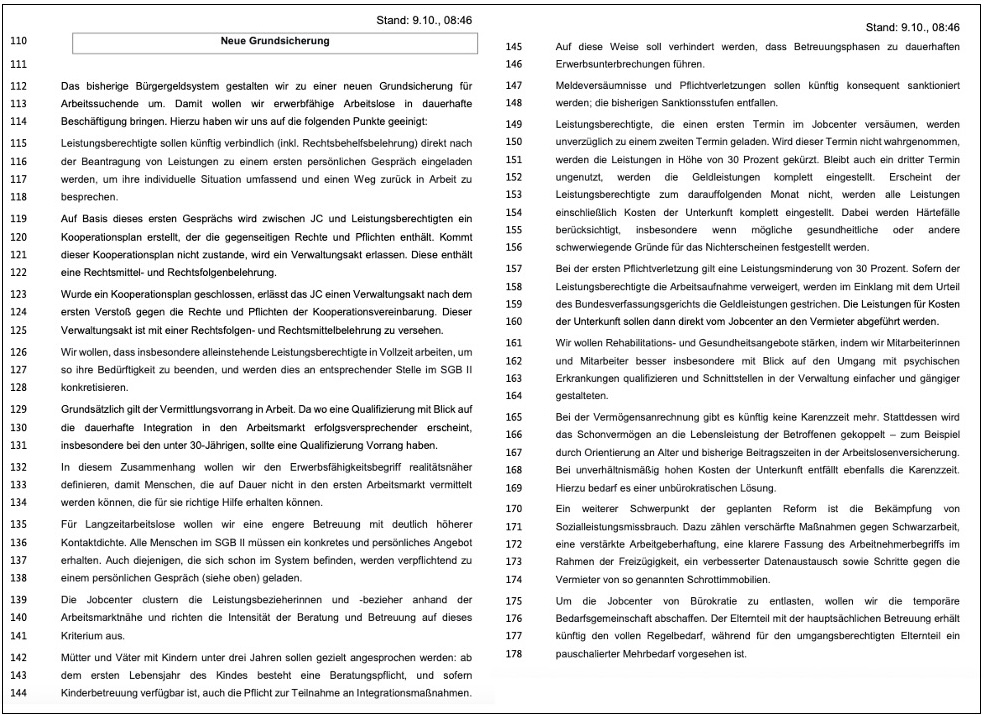
Sanktionen, immer diese Sanktionen
In der Rezeption der Beschlüsse dominierte in den Tagen nach der Veröffentlichung die Auseinandersetzung mit den dort enthaltenen Vorhaben die Sanktionierung in der Grundsicherung betreffend. Das ist auch nicht wirklich überraschend, wenn man bedenkt, dass in den zurückliegenden Monaten die Leute im wahrsten Sinne des Wortes auf die Bäume getrieben wurden rund um die in der öffentlichen Debatte in extensio ausgebreitete Kunstfigur des „Totalverweigerers“ und darüber hinaus der versteckt oder auch sehr offen vorgetragenen „Daignose“, dass zahlreiche Bürgergeld-Empfänger eine ruhige Kugel im Leistungsbezug schieben und es sich gut gehen lassen ohne anstrengende Erwerbsarbeit. Dass man endlich die Daumenschrauben (wieder und noch weitaus stärker) anziehen müsse als vor diesem Bürgergeld, also in der alten Hartz IV-Welt.
Und tatsächlich offenbaren die Beschlüsse des Koalitionsausschusses (die ja noch in ein konkretes Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des SGB II gegossen und operationalisiert werden müssen), durchaus eine – wertfrei formuliert – „Weiterentwicklung“ des Sanktionsregimes in der Grundsicherung. Die nun geplanten Verschärfungen der Sanktionen beziehen sich zum einen auf die bereits heute mögliche Vollsanktionierung, die allerdings nur sehr wenige Fälle betrifft bzw. betreffen wird, zum anderen zeigt ein schneller Vergleich mit den existierenden (und von der Vorgänger-Regierung, also der Ampel-Koalition bereits verschärften)1 Sanktionen, dass es in einem Bereich tatsächlich erhebliche Sanktions-Verschärfungen geben soll und nach einer noch ausstehenden gesetzgeberischen Konkretisierung auch geben wird: konkret bei den Meldeversäumnissen. Davon separiert sind die Pflichtverletzungen, die strukturell intensiver sanktioniert werden (sollen).
| Das bisherige Sanktionsregime im SGB II: Bei den Rechtsfolgen wird unterschieden zwischen Pflichtverletzungen (§ 31 SGB II) und Meldeversäumnissen (§ 32 SGB II). Grundsätzlich gilt als Schutzformulierung: Wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und diesen nachweisen können, dann darf keine Kürzungen der Leistungen vorgenommen werden. ➞ Zu den Pflichtverletzungen gehört beispielsweise die Weigerung, sich an Vereinbarungen aus dem Kooperationsplan nach § 15 SGB II zu halten sowie die in der öffentlichen Debatte so dominante Weigerung, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen, aber auch eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit anzutreten oder eine solche abzubrechen.2 Im § 31a SGB II sind dann die Rechtsfolgen solcher Pflichtverletzungen geregelt: Bei einer (ersten) Pflichtverletzung wird der Regelbedarf um 10 Prozent für einen Monat gemindert, bei einer zweiten3 Pflichtverletzung um 20 Prozent für zwei Monate. Kommt eine dritte Pflichtverletzung hinzu, dann mindert sich das Bürgergeld um 30 Prozent jeweils für drei Monate. Wir haben hier also eine Stufenregelung. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kürzungen des Regelbedarfs aufzuheben sind, „sobald erwerbsfähige Leistungsberechtigte diese Pflichten erfüllen oder sich nachträglich ernsthaft und nachhaltig dazu bereit erklären, diesen künftig nachzukommen.“ Und eine weitere Einschränkung: „Eine Leistungsminderung erfolgt nicht, wenn sie im Einzelfall eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde.“ Leistungsminderungen sind grundsätzlich auf insgesamt 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs begrenzt. Eine Minderung der anteiligen Zahlbeträge für die Kosten der Unterkunft und Heizung darf nicht vorgenommen werden. Man achte aber auf die Formulierung, das „grundsätzlich“ nicht mehr als 30 Prozent gekürzt werden dürfen – denn das verweist auf mögliche Ausnahmen. Und die findet man im bereits von der Vorgänger-Regierung im § 31a Abs. 7 verankerte Möglichkeit einer Vollsanktionierung: Wenn Leistungsempfänger innerhalb eines Jahres sich erneut weigern, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen, dann entfällt der Leistungsanspruch auf den Regelbedarf in voller Höhe. Mit dieser Voraussetzung: „ Die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme muss tatsächlich und unmittelbar bestehen und willentlich verweigert werden.“ ➞ Bei den Meldeversäumnissen nach § 32 SGB II sieht es derzeit so aus, dass bei einem Meldeversäumnis eine Leistungskürzung um jeweils 10 Prozent des Regelbedarfs vorgesehen ist. |
Und was soll sich nun ändern in der Welt der „neuen Grundsicherung“ bei den Sanktionen?
Die entscheidende Formulierung im Beschlusstext des Koalitionsausschusses lautet:
»Meldeversäumnisse und Pflichtverletzungen sollen künftig konsequent sanktioniert werden; die bisherigen Sanktionsstufen entfallen.«
Es handelt sich vor allem um eine deutliche Verschärfung der Sanktionsandrohung im Bereich der Meldeversäumnisse. Nach dem Beschluss des Koalitionsausschusses soll direkt eingestiegen werden mit einer Leistungskürzung in Höhe von 30 Prozent – die sich dann auch bei Meldeversäumnissen bis zur kompletten Leistungseinstellung – einschließlich der Kosten der Unterkunft – steigern kann:
»Leistungsberechtigte, die einen ersten Termin im Jobcenter versäumen, werden unverzüglich zu einem zweiten Termin geladen. Wird dieser Termin nicht wahrgenommen, werden die Leistungen in Höhe von 30 Prozent gekürzt. Bleibt auch ein dritter Termin ungenutzt, werden die Geldleistungen komplett eingestellt. Erscheint der Leistungsberechtigte zum darauffolgenden Monat nicht, werden alle Leistungen einschließlich Kosten der Unterkunft komplett eingestellt.«
Auch hier wird eine Ausnahmemöglichkeit eröffnet: »Dabei werden Härtefälle berücksichtigt, insbesondere wenn mögliche gesundheitliche oder andere schwerwiegende Gründe für das Nichterscheinen festgestellt werden.«
Und wie sieht es bei den Pflichtverletzungen aus?
Dazu gibt es diesen Passus: »Bei der ersten Pflichtverletzung gilt eine Leistungsminderung von 30 Prozent. Sofern der Leistungsberechtigte die Arbeitsaufnahme verweigert, werden im Einklang mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Geldleistungen gestrichen. Die Leistungen für Kosten der Unterkunft sollen dann direkt vom Jobcenter an den Vermieter abgeführt werden.«
Ganz offensichtlich soll hier die gerade von Linnemann und anderen hervorgehobene Figur des „Arbeitsverweigerers“ gleich richtig in die Mangel genommen werden.
Dass das alles offensichtlich mit heißer Feder geschrieben wurde, kann man beispielsweise der Ungleichbehandlung der Unterkunftskosten im neuen Sanktionsregime entnehmen: Während die KdU-Leistungen bei Meldeversäumnissen nach dem dritten Termin und dem Nicht-Erscheinen im Folgemonat mit den Leistungen für den Regelbedarf komplett eingestellt werden sollen, ist das bei einer Vollsanktionierung aufgrund einer Arbeitsverweigerung nicht der Fall – in diesem Fall sollen sie (direkt an den Vermieter) weitergezahlt werden.
Hinter der Verschärfung des Sanktionsregimes im SGB II (im Sinne einer Rückkehr zu Regelungen, die es schon mal gegeben hat in der alten Hartz IV-Welt plus zusätzlichen Daumenschrauben) steht die Erwartung oder besser Hoffnung, dadurch die in den öffentlichen Raum gestellten „Einsparungen“ realisieren zu können (was nicht ansatzweise gelingen wird). Ergänzt werden soll die so zu schlagende Schneise um weitere Restriktionen mit einem theoretischen Einsparpotenzial: »Bei der Vermögensanrechnung gibt es künftig keine Karenzzeit mehr. Stattdessen wird das Schonvermögen an die Lebensleistung der Betroffenen gekoppelt – zum Beispiel durch Orientierung an Alter und bisherige Beitragszeiten in der Arbeitslosenversicherung. Bei unverhältnismäßig hohen Kosten der Unterkunft entfällt ebenfalls die Karenzzeit.« Man soll also Vermögen früher und umfangreicher einsetzen für die eigene Bedarfsdeckung – eine für viele durchaus nicht unverschämte Forderung bei einer bedürftigkeitsabhängigen Sozialhilfeleistung. Wenn da nur nicht die bekannte Tatsache wäre, dass die allermeisten Bürgergeld-Empfänger über nur geringe oder gar keine Vermögen verfügen, was dann diese anzuzapfende Quelle schnell als das entlarven wird, was es ist: ein ausgetrockneter Brunnen. Und bei der Streichung der Karenzzeit bei den Unterkunftskosten kehr man im Grunde in die alte Welt von Hartz IV zurück – und zugleich findet man in dem Beschlusspapier des Koalitionsausschusses wie ein letztes Aufstöhnen derjenigen, die um die Untiefen der Umsetzung dieser Forderung wissen, diesen reinbugsierten Satz: »Hierzu bedarf es einer unbürokratischen Lösung.« Na dann.
Und abgerundet wird das dann durch die heroische Hervorhebung, man wolle nun aber den Sozialleistungsmissbrauch so richtig bekämpfen: »Dazu zählen verschärfte Maßnahmen gegen Schwarzarbeit, eine verstärkte Arbeitgeberhaftung, eine klarere Fassung des Arbeitnehmerbegriffs im Rahmen der Freizügigkeit, ein verbesserter Datenaustausch sowie Schritte gegen die Vermieter von so genannten Schrottimmobilien.«
Man darf auf die gesetzgeberische Konkretisierung gespannt sein.
Wie auch immer das ausgestaltet wird – neben den Auswirkungen auf die betroffenen Menschen wird der damit verbundene Aufwand für die Jobcenter erheblich sein, denn das muss alles rechtssicher umgesetzt werden. Und gleichzeitig erwartet die bekanntlich nicht unterausgelasteten Mitarbeiter der Jobcenter nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses weitere erhebliche Aufgabenausweitungen.
Von vielen Besprechungen, verbindlichen Angeboten und zahlreichen einzelfallbezogenen Ausnahmeprüfungen. Das schreibt sich einfacher, als es in der Praxis sein wird
Schaut man in den Beschlusstext des Koalitionsausschusses – zur Erinnerung: es handelt sich um ein Gremium der Spitzen der derzeitigen Regierungskoalition -, dann reibt man sich verwundert die Augen, denn wie bei den beschriebenen neuen (alten) Sanktionsregelungen wird auch an anderen Stellen in einer Detailtiefe argumentiert, die wie eine Aufgaben- und Prozessbeschreibung aus dem Instrumentenkasten der angewandten Verwaltungskunde daherkommen.
Gleich am Anfang der Beschreibung der „neuen Grundsicherung“ finden wir beispielsweise diese Anweisung an die Jobcenter das zukünftige Vorgehen betreffend:
»Leistungsberechtigte sollen künftig verbindlich (inkl. Rechtsbehelfsbelehrung) direkt nach der Beantragung von Leistungen zu einem ersten persönlichen Gespräch eingeladen werden, um ihre individuelle Situation umfassend und einen Weg zurück in Arbeit zu besprechen.« Es wird sicher viele geben, die an dieser Stelle etwas irritiert anmerken würden: Machen die Jobcenter das nicht schon? Ist das der Regelfall, dass sie sich nach dem Antrag auf Leistungen Monate oder vielleicht Jahre Zeit lassen, um ihre „Kunden“, wie die Leistungsempfänger euphemistisch betitelt werden, mal zu sprechen?
Aber gut. Nun sollen die Leute also so schnell wie möglich zu einem persönlichen Gespräch eingeladen werden (der Zusatz inkl. Rechtsbehelfsbelehrung verweist dann auf den möglichen Beifang an Leistungskürzungen im Fall des Nicht-Erscheinens). Und dann?
»Auf Basis dieses ersten Gesprächs wird zwischen JC und Leistungsberechtigten ein Kooperationsplan erstellt, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten enthält.« Einen Kooperationsplan gibt es schon im SGB II (§ 15 SGB II: Potenzialanalyse und Kooperationsplan), aber die Formulierung im Beschlusstext erinnert an Regelungen vor dem Bürgergeld. Und es wird sogleich hinterhergeschoben: »Kommt dieser Kooperationsplan nicht zustande, wird ein Verwaltungsakt erlassen.« Der ist dann der Einstieg in eine Sanktionierung wegen fehlender Mitwirkung. Und wenn ein Kooperationsplan geschlossen wurde, »erlässt das JC einen Verwaltungsakt nach dem ersten Verstoß gegen die Rechte und Pflichten der Kooperationsvereinbarung.«
Und wo sind weitere Aufgabenzuschreibungen für die Mitarbeiter in den Jobcentern? Die müssen umsetzen, was von oben vorgegeben wird, beispielsweise:
»Wir wollen, dass insbesondere alleinstehende Leistungsberechtigte in Vollzeit arbeiten, um so ihre Bedürftigkeit zu beenden.« Und man wolle das auch im SGB II konkretisieren. Die Umsetzung dieses Wollens aber wird für das Jobcenter nicht vom Himmel fallen, sondern man muss die entsprechenden Einzelfälle in diese Richtung beraten, unterstützen und auch kontrollieren, ob sie sich an die Arbeitszeitverhaltenserwartung halten.
Und ein weiteres Möbelstück aus der alten Hartz IV-Welt wird wiederbelebt: »Grundsätzlich gilt der Vermittlungsvorrang in Arbeit.« Also wieder als Regelfall, so schnell wie möglich in irgendwas vermitteln. Zugleich schreibt man dann diese Einschränkung rein: »Da wo eine Qualifizierung mit Blick auf die dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt erfolgsversprechender erscheint, insbesondere bei den unter 30-Jährigen, sollte eine Qualifizierung Vorrang haben.« Auch das muss nun einzelfallbezogen geprüft und ggfs. begründet werden.
Und weitere auf den ersten Blick doch vernünftig daherkommende Textbausteine, die aber mit einer sehr personalaufwendigen Umsetzung verbunden wären, findet man in dem Beschlusstext:
»Für Langzeitarbeitslose wollen wir eine engere Betreuung mit deutlich höherer Kontaktdichte. Alle Menschen im SGB II müssen ein konkretes und persönliches Angebot erhalten. Auch diejenigen, die sich schon im System befinden, werden verpflichtend zu einem persönlichen Gespräch (siehe oben) geladen.«
Hier muss die Frage erlaubt sein: Was muss man sich denn unter einem „konkreten und persönlichen Angebot“ genau vorstellen? Ein neuer Job? Irgendeine Maßnahme? Und was machen die Jobcenter, wenn sie partout keine und dann auch noch passenden Jobs anzubieten haben? Und wenn sie nicht mal irgendwelche Maßnahmen anbieten können, weil die Topf mit den Mitteln für Eingliederungsleistungen leer ist?
Auf der Ebene, auf der das Papier zusammengeschustert wurde, können zahlreiche Widersprüche nicht überraschen. Beispiel: Wie bereits erwähnt fordert die Koalitionsspitze von den Jobcentern: »Für Langzeitarbeitslose wollen wir eine engere Betreuung mit deutlich höherer Kontaktdichte.« Das könnte man durchaus nachvollziehen, wenn denn die Kontaktdichte zu einer schnelleren oder überhaupt den Einstieg in eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt führen wird. Zugleich kommt dann aber dieser Passus, der richtig gelesen eigentlich andeutet, dass man zumindest bei den Langzeitarbeitslosen mit zahlreichen „Vermittlungshemmnissen“ die knappen Ressourcen nicht investiert: »Die Jobcenter clustern die Leistungsbezieherinnen und -bezieher anhand der Arbeitsmarktnähe und richten die Intensität der Beratung und Betreuung auf dieses Kriterium aus.« Was ja wohl heißen soll: Je arbeitsmarktnäher, desto intensiver die Beratung und Betreuung – obwohl man natürlich auch argumentieren könnte, genau umgekehrt, also wenn jemand arbeitsmarktnah ist, dann kann und wird er sich schon selbst helfen (können). Es ist kompliziert.
Und dann gibt es da noch einen (potenziell) ganz bedeutsamen Punkt, der sich versteckt zwischen den Absätzen findet – und der schon seit vielen Jahren immer wieder in die Debatte geworfen wird: Man wolle nun den »Erwerbsfähigkeitsbegriff realitätsnäher definieren, damit Menschen, die auf Dauer nicht in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden können, die für sie richtige Hilfe erhalten können.« Dahinter steht der tatsächlich auch im internationalen vergleich sehr weit gefasste Erwerbsfähigkeitsbegriff in Deutschland – und der Zugang zum SGB II-System ist ja an die Erwerbsfähigkeit gekoppelt (ansonsten bietet sich der Verweis auf andere Sozialsysteme wie die Sozialhilfe nach SGB XII oder auch das Erwerbsunfähigkeitssystem der Rentenversicherung an). Wenn man wirklich den Zugang zum SGB II-System begrenzen und teilweise verschließen will, dann wäre das Outsourcing der als nicht mehr erwerbsfähig klassifizierten Menschen eine zentrale Stellschraube. Was man aber auch erst einmal rechtssicher normieren muss, deshalb die eher wolkige Inaussichtstellung, dass es eine „realitätsnähere Definition der Erwerbsfähigkeit“ geben soll.
Ein vorläufiges Fazit: Es gibt viele Stellen in dem anstehenden Gesetzgebungsprozess, auf deren Ausformulierung man gespannt sein darf. Eines ist aber bei diesen teilweise nebulösen, in anderen Fällen extrem kleinteilig angelegten Verfahrensanforderungen klar wie das Amen in der Kirche: Das wird enormen Mehraufwand für die personengebundene Umsetzung in den letzten Außenposten unseres Sozialstaats, also den Jobcentern, produzieren müssen, denn es sind keine erheblichen Entlastungen des Personals an anderer Stelle zu erkennen, die den Mehraufwand auch nur kompensieren könnten. Und das trifft auf ein Institutionengefüge, dass seit Jahren strukturell unterfinanziert ist. Keine gute Perspektiven sowohl für die Menschen hinter wie vor den Schreibtischen.
| Mit Bearbeitungsstand 16.10.2025 wurde ein 92 Seiten umfassender erster Aufschlag für die anstehende gesetzgeberische Umsetzung aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vorgelegt: ➔ Referentenentwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze. Bearbeitungsstand: 16.10.2025 Dieser erste Entwurf ist an die anderen Ministerien zur Ressortabstimmung weitergeleitet worden. |
Fußnoten
- Mit dem Zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 wurden – befristet für zwei Jahre – wieder deutlich härtere Regelungen eingeführt: Wer eine zumutbare Arbeit verweigert und bereits im Jahr zuvor eine Leistungsminderung hatte, kann seinen Anspruch auf den Regelbedarf komplett verlieren (also mit einer „Totalsanktion“ belegt werden) – und das für bis zu zwei Monate. Diese Regelung betrifft insbesondere den neuen § 31a Abs.7 und § 31b Abs.3 SGB II. Für eine genauere Darstellung der Entwicklung des Sanktionsrechts – vom „Sanktionsmoratorium“ über die Bürgergeld-Phase bis zu den 2024 vorgenommenen Verschärfungen in der verkürzten Legislaturperiode der Ampel-Regierung vgl. die Darstellung in dem Beitrag von Judith Bendel-Claus und Lena Bösel (2025): Die Grundsicherung für Arbeitsuchende während der Ampelkoalition – wesentliche Änderungen von 2022 bis 2024, in: IAB-Forum, 12.06.2025. ↩︎
- Ebenfalls eine Pflichtverletzung stellt das sogenannte „sozialwidrige Verhalten“ dar, also wenn die Leistungsbezieher nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert haben, die Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung des Bürgergeldes herbeizuführen, und sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen. ↩︎
- Eine weitere (also zweite oder darüber hinausgehende) Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegangenen Minderungszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. ↩︎