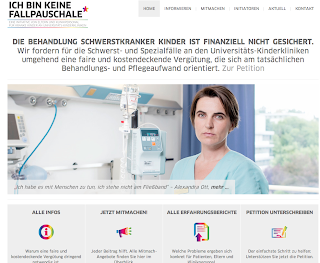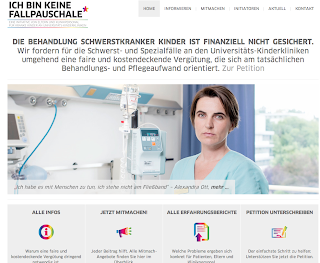Die Fallpauschalen als zentrale Komponente der Krankenhausfinanzierung in Deutschland sind zehn Jahre geworden: „Ein Geburtstag, der Fragen aufwirft„, so der Publizist Uwe K. Preusker in einem Beitrag für die „Ärzte Zeitung“. »Das gerade zehn Jahre alt gewordene deutsche Fallpauschalensystem als Basis für die Vergütung stationärer Leistungen gerät immer häufiger in die Kritik. Es betone zu stark die Ökonomie und fördere die Leistungsmenge – so lauten zentrale Kritikpunkte«, so Preusker. Dafür gibt es ja auch zahlreiche Belege, beispielsweise bei den vielen Knie- und Rücken-OPs in Deutschland. Oder die in die Kritik geratenen Chefarztverträge, in denen Zulagen für die Realisierung bestimmter Mengenvorgaben fixiert wurden. Man könnte die Liste beliebig fortsetzen.
Man muss an dieser Stelle kurz erinnern: Bis zur Einführung der Fallpauschalen gab es in den deutschen Krankenhäusern tagesgleiche Pflegesätze, die nach den einzelnen Abteilungen und Kliniken differenziert waren und im Prinzip dem Selbstkostendeckungsprinzip folgen sollten. Dies wurde – nicht unplausibel – als tendenziell unwirtschaftlich problematisiert, denn diese Vergütungsform beinhaltete den Anreiz, die Patienten länger als notwendig in den Kliniken zu halten. Und viele ältere Semester werden sich erinnern, dass es damals schlichtweg nicht vorgekommen ist, dass man an einem Freitag entlassen wurde, sondern frühestens am Montag, denn für die Tage dazwischen bekam das Krankenhaus den gleichen Pflegesatz wie unmittelbar am Tag nach einer OP, was natürlich angesichts der Tatsache, dass die Patienten im Wesentlichen nur noch Hotellerieleistungen in Anspruch nahmen, ein gutes Geschäft war.
Diese Zeiten sind nun schon seit längerem vorbei. Aber die Deutschen haben vor zehn Jahren – bei dem Systemwechsel hin zu einem „vollständig fallpauschalierenden System“ der Krankenhausvergütung – wieder einmal so agiert wie so oft: Wenn sie etwas machen, dann aber „richtig“, will heißen, möglichst kompromisslos. Preusker dazu:
»Bei der Einführung des DRG-Systems hat Deutschland einen Weg eingeschlagen, den bis dahin kein anderes der rund 50 Länder eingeschlagen hatte, die international DRGs nutzen: In Deutschland sollte das DRG-System die bis dahin geltende Finanzierung der stationären Versorgung zu 100 Prozent ersetzen.
Schaut man in andere Länder, so hat man dort fast überall auf Systeme gesetzt, die eine Mischfinanzierung vorsehen, so zum Beispiel in Norwegen und Dänemark … Hinzu treten in vielen Ländern, die Fallpauschalen zur Honorierung stationärer Leistungen einsetzen, ergänzende Zuweisungen für besondere Leistungen: etwa für Vorhaltekosten. Auch die hochspezialisierte Versorgung oder die universitäre Medizin werden durch besondere Mechanismen außerhalb des Fallpauschalensystems finanziert.«
Womit wir schon mittendrin sind in den aktuellen Problemen, die sich herausgebildet haben aufgrund der Mechanik, die dem deutschen Fallpauschalensystem inhärent sind. Wenn die Krankenhäuser beispielsweise für eine bestimmte OP in einem Bundesland (tendenziell mal in ganz Deutschland) die gleiche Fallpauschale bekommen, mit der sie alle Kosten decken müssen, dann ist natürlich klar, dass die Kliniken, die sich auf diese OP spezialisiert haben und diese in großer Fallzahl durchführen (können), einen klaren Startvorteil haben gegenüber den Krankenhäusern, bei denen diese OP vielleicht nur 5 oder 10 mal im Jahr anfällt. Insofern hat das neue Finanzierungssystem zu einer massiven Spezialisierung der Kliniken beigetragen, was aber auch gewollt war. Nur gibt es eben Krankenhäuser, beispielsweise der Grundversorgung in den ländlichen Räumen, die auch wenn sie wollten niemals die Spezialisierungsvorteile von Kliniken mit einem partikularen Leistungsspektrum erreichen können. Die rauschen dann schnell in die Verlustzone, während die anderen mit den Pauschalen durchaus gewinn machen können.
Und noch für eine weitere Gruppe an Kliniken gibt es teilweise existenzbedrohende Risiken, die sich aus dem neuen System ableiten lassen: Die Fallpauschalen, das muss man an dieser Stelle wissen, sind durchschnittskostenkalkulierte Beträge, die sich hinsichtlich einer bestimmten Diagnose und/oder Preozedur auf Durchschnittsdauern beziehen. Daraus und aus der Tatsache, dass man die Zahl der DRGs (das sind die Diagnosen bzw. Prozeduren, die mit einer Pauschale belegt sind) überschaubar halten möchte, folgt als Kollateralschaden angesichts der Heterogenität der Fälle und Fallkonstellationen, dass es für besonders schwierige und damit natürlich auch aufwandsseitig teure Fälle zu wenig Geld gibt aus der Fallpauschale, die sich immer auf einen Standardfall beziehen muss. Genau in dieses Dilemma sind viele Kliniken der Maximalversorgung hineingelaufen, was man derzeit wieder einmal in der Berichterstattung am Beispiel der Kindermedizin beobachten kann.
„Kind gerettet, Krankenhaus in den Miesen„, unter dieser Überschrift thematisiert Nina von Hardenberg in der Süddeutschen Zeitung, dass seltene Krankheiten für Kliniken oft ein Verlustgeschäft darstellen, da sie nur einen Teil der Behandlungskosten erstattet bekommen. Das spüren vor allem universitäre Einrichtungen, die viele Patienten mit solchen Leiden aufnehmen. In Tübingen protestieren nun Eltern gegen das Abrechnungssystem. Und das hat es in sich: »Die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin hat im vergangenen Jahr 489 Kinder aufgenommen, die die Klink 50 Prozent mehr gekostet haben, als die Krankenkassen erstatteten. Diese Kostenausreißer machten zwar weniger als fünf Prozent aller Patienten aus, doch mit ihnen machte die ohnehin defizitäre Klinik immerhin 2,17 Millionen Euro Minus.«
»In Tübingen haben sich nun Eltern- und Fördervereine zusammengeschlossen, um für eine bessere Finanzierung der Klinik zu werben. Unter dem Motto „Ich bin keine Fallpauschale“ stellen sie im Internet Kinder vor, die im derzeitigen Abrechnungssystem den Kliniken, die ihnen helfen, eine ungedeckte Rechnung hinterlassen.«
Eltern und Klinikpersonal haben eine Petition erarbeitet, mit der sie für die Schwerst- und Spezialfälle an den Universitäts-Kinderkliniken umgehend eine faire und kostendeckende Vergütung, die sich am tatsächlichen Behandlungs- und Pflegeaufwand orientiert, fordern. Hierfür haben Sie eine eigene Webseite eingerichtet: „Ich bin keine Fallpauschale„.
Hardenberg weist zu recht darauf hin, dass es sich hierbei um ein generelles Systemproblem handelt: »Tatsächlich sind Kostenausreißer kein Problem der Kindermedizin allein. Derzeit zahlen alle Krankenhäuser drauf, wenn ein Patient eine besonders komplizierte oder langwierige Behandlung benötigt. Im System der Fallpauschalen erhalten Klinken schließlich für jeden Patienten eine fixe Summe, die sich an den durchschnittlichen Kosten für die Behandlung bemisst. Dafür verdienen sie aber umgekehrt auch zusätzlich, wenn Patienten schneller als der Schnitt genesen. So sollen sich schwere und leichtere Fälle ausgleichen.«
Sie deutet an, dass es Hoffnung gibt für die betroffenen Krankenhäuser – die allerdings noch auf sich warten lassen wird: »Die Bundesregierung hat in einem der letzten Gesetze vor der Sommerpause beschlossen, das Problem der Kostenausreißer im Jahr 2014 wissenschaftlich untersuchen zu lassen. 2015 könnte mit den Ergebnissen der Studie dann eine Extravergütung für diese Patienten entwickelt werden.« Das muss man natürlich – sollte es überhaupt so kommen – erst einmal überbrücken.
Nun gab es einen Bereich, den man damals bewusst ausgeschlossen hatte von der Einführung eines durchgängig fallpauschalierenden Systems: die Psychiatrien. Hier wird weiterhin mit tagesgleichen Pflegesätzen vergütet. Aber auch dieser Teil der deutschen Krankenhauslandschaft soll nun eingegliedert werden in die schöne neuen Vergütungswelt, doch dagegen hat sich Widerstand entwickelt: Es geht um das „Pauschalierende Entgeltsystem in Psychiatrie und Psychosomatik“ (PEPP).
Der aktuelle PEPP-Katalog für das Jahr 2013 enthält insgesamt 135 tagesbezogene Entgelte für voll- und teilstationäre Leistungen und 75 Zusatzentgelte, die für hochaufwendige Leistungen bezahlt werden. Psychiatrische und psychosomatische Krankenhäuser werden zukünftig ihre Leistungen auf Basis des PEPP-Katalogs abrechnen; ab Januar 2013 freiwillig, ab 2015 verpflichtend. Den neuen Entgeltkatalog hat das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) kalkuliert (Quelle: AOK zum PEPP)
Barbara Dribbusch beschreibt in ihrem Artikel „Tagessätze je nach Diagnose“ an einem Beispiel das mit dem neuen Entgeltsystem verbundene Problem: »16 Tage. So lange darf ein an Schizophrenie Erkrankter nach dem Entwurf eines neuen Entgeltsystem künftig in der Psychiatrie bleiben, während die Klinik den höchsten Tagessatz kassiert. Dauert der Aufenthalt länger, wird beim Tagessatz gekürzt.« Das neue Entgeltsystem werde „hoch individuellen Verläufen“ bei psychischen Erkrankungen nicht gerecht, so wird Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands, in dem Artikel zitiert. Rosenbrock, der sich in den Untiefen des deutschen Gesundheitssystems gut auskennt, weist auf eine Dilemma hin, das mit dem neuen System verbunden ist: »Mit den degressiven Tagessätzen in PEPP würden einerseits schwerer erkrankte Patienten möglicherweise zu früh entlassen, andererseits aber gebe es einen Anreiz, leichter Erkrankte so lange dazubehalten, bis die maximale Dauer für die höchste Vergütungsstufe ausgereizt sei«.
Die Befürworter des Systems weisen allerdings darauf hin, dass mit dem neuen System je nach Diagnose unterschiedliche Tagessätze gezahlt werden, was heute nicht der Fall ist, da die gegenwärtigen klinikindividuellen Pflegesätze unabhängig von der Erkrankung des Patienten stets gleich sind.
Kritiker hingegen weisen beispielsweise darauf hin, dass im PEPP-Katalog Leistungen etwa der Sozialarbeiter oder der Ergotherapeuten nicht erfasst werden. Diese würden als „Hintergrundrauschen“ nicht abgebildet.
Wir sprechen hier keineswegs über eine Orchideendisziplin, wenn wir auf die Psychiatrien schauen: Jährlich gibt es fast eine Million stationäre Aufnahmen, Tendenz steigend. Das ganze betrifft also viele Menschen.
Kommen wir abschließend und ausblickend zurück zu dem Beitrag „Ein Geburtstag, der Fragen aufwirft“ von Uwe K. Preusker, einem versierten Beobachter der Entwicklungen in der deutschen Krankenhauslandschaft: »Angezeigt wäre … eine Ergänzung des G-DRG-Systems durch Qualitätskriterien, die dann schrittweise einen größeren Einfluss auf die Vergütung bekommen könnten. Außerdem müssen nachgewiesene Fehlanreize, die das gegenwärtige System aufweist, durch sinnvolle Neuregelungen ersetzt werden. Und die Wege, die viele andere Länder eingeschlagen haben, weisen auch darauf hin, dass man individuelle Finanzierungsinstrumente benötigt, wenn man politisch priorisierte Ziele erreichen will, etwa eine flächendeckende Versorgung.«
Der entscheidende Aspekt mit Blick auf die Zukunft und die von vielen kritisierte fortbestehende Trennung zwischen stationärer und ambulanter Versorgung ist aber der folgende Gedanke von Preusker:
»Vor allem aber sollte man bei jeder Weiterentwicklung der existierenden Vergütungssysteme berücksichtigen, dass ambulante und stationäre Versorgung tendenziell immer stärker zusammenwachsen – irgendwann bedeutet dies unweigerlich, dass beide Sektoren auch unter ein gemeinsames Dach einheitlicher Vergütungsregularien kommen.«
Das wird noch eine Menge Arbeit und ein langer Weg.