„Die“ Lebenserwartung und ihre Entwicklung ist nicht nur für uns alle höchst relevant und interessant, sondern sie spielt in der sozialpolitischen Diskussion an mehreren Stellen eine bedeutsame Rolle. Man denke hier nur an die Debatte über eine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Nicht nur bei der bereits vollzogenen schrittweisen Anhebung auf 67 Jahre (diese Grenze gilt dann nicht zufälligerweise voll zum ersten Mal für den Jahrgang 1964, den geburtenstärksten Jahrgang und damit die Frontrunner der Baby-Boomer) wurde immer wieder auf die ansteigende Lebenserwartung hingewiesen, sondern auch aktuell bedienen sich die Apologeten einer weiteren „unvermeidlichen“ Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters der für viele auf den ersten Blick auch nachvollziehbaren Argumentationsfigur, dass wenn wir alle ein paar Jahre länger leben werden, dann muss man auch das Renteneintrittsalter nach oben anheben.
Nun ist bekanntlich alles ungleich verteilt im Leben. Vermögen, Einkommen, Liebe – und eben auch „die“ Lebenserwartung. Denn „die“ gibt es nicht, alle Berichte mit dem Bild, dass „wir drei oder vier Jahre länger leben werden“, bedienen sich an einem Durchschnittswert, der aber zuweilen mit spitzen Fingern anzufassen ist – vor allem dann, wenn die Streuung der Einzelwerte um den statistischen Durchschnitt erheblich ist. Und so ist das gerade bei „der“ Lebenserwartung, die es gar nicht gibt, sondern wenn, dann sehr unterschiedliche Lebenserwartungsentwicklungen. Die wiederum von sehr persönlichen Faktoren abhängen (wie jemand gelebt oder sein Leben verlebt hat), aber eben auch von zahlreichen strukturellen Einflussfaktoren, also wo jemand in welchen Verhältnisse und wie lange leben musste oder konnte
Diese Thematik wurde in diesem Blog an vielen Stellen behandelt. Beispielsweise in dem Beitrag „Wir“ werden (nicht alle) immer älter. Über den Zusammenhang von steigender Lebenserwartung, zunehmender Einkommensungleichheit schon vor der Rente und Altersarmut vom 20. Juni 2019. Oder die Instrumentalisierung der Vorhersage der Lebenserwartung im Bereich der privaten Altersvorsorge, hierzu der Beitrag Bei Riester-Menschen können es auch schon mal bis zu 150 Jahre werden. Warum Versicherungsunternehmen mit völlig überzogenen Lebenserwartungen kalkulieren vom 10. Mai 2020, um nur zwei Beispiele explizit zu nennen.
Nun wurde eine neue und sehr interessante Studie veröffentlicht, die sich mit einer regionalen Differenzierung der Lebenserwartung beschäftigt:
➔ Roland Rau und Carl P. Schmertmann (2020): Lebenserwartung auf Kreisebene in Deutschland, in: Deutsches Ärzteblatt, Heft 29–30/2020
Die Identifikation von Regionen mit niedriger Lebenserwartung ist wichtig für politische Entscheidungsträger, insbesondere bei der Allokation von Ressourcen im Gesundheitssystem. Schätzungen für die Lebenserwartung in kleinräumigen Regionen sind jedoch oft unzuverlässig und führen zu statistischen Unsicherheiten, wenn die zugrunde liegenden Bevölkerungszahlen relativ klein sind, so beschreiben die beiden Autoren das Problem. Denn: »Kleinräumige Schätzungen sind … entscheidend, marginalisierte Regionen zu identifizieren. Dies ist insbesondere wichtig in Hinblick auf Art. 72 [2] des Grundgesetzes, der dem Bund das Gesetzgebungsrecht zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse zuweist.«
Was haben die beiden gemacht? »Um solche Regionen besser identifizieren zu können, haben wir – basierend auf altersspezifischen Mortalitätsraten – die Lebenserwartung auf Kreisebene für Frauen und Männer in Deutschland geschätzt.«
➔ Für die Liebhaber statistischer Methodenfragen erläutern Rau/Schmertmann: »Einerseits wollten wir für kleinräumige Gegenden zuverlässige Schätzungen vorlegen, die aufgrund der zugrunde liegenden geringen Einwohnerzahl nicht den Nachteil haben, instabil und mit großer Unsicherheit behaftet zu sein. Normale Schätzverfahren sind bei niedrigen Einwohnerzahlen anfällig für zufällige, statistische Schwankungen, wenn auf Grundlage nur sehr weniger Sterbefälle die Sterberate geschätzt werden soll. Zusätzlich liefert unser statistischer Ansatz auch Schätzwerte für die zugrunde liegenden Unsicherheiten. Solche Schätzungen der Unsicherheit sind dann von Nutzen, wenn man Aussagen treffen möchte, ob die Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen zwei Kreisen wohl tatsächlich existieren oder lediglich ein Zufallsergebnis sind, da nur wenige Sterbefälle in Kreisen moderater Größe vorliegen. Unseres Wissens wurden bisher keine solchen Intervallschätzungen für die Lebenserwartung auf Kreisebene in Deutschland veröffentlicht.«
Sozialpolitisch besonders relevant ist diese Zielsetzung der Studienautoren: »Zudem wollen wir untersuchen, ob es bestimmte Korrelationsmuster zwischen sozialen und ökonomischen Indikatoren auf Kreisebene und der dortigen Lebenserwartung gibt. Es ist bekannt, dass arme, benachteiligte und weniger (formal) gebildete Personen eine niedrigere Lebenserwartung haben als Personen mit höherem Einkommen, besseren wirtschaftlichen Möglichkeiten oder einem Universitätsabschluss … Dies liegt nicht nur am Einkommen oder den Ressourcen an sich, sondern unter anderem auch an der höheren Prävalenz ungesunder Verhaltensweisen, wie zum Beispiel schlechter Ernährung, Rauchen oder übermäßigem Trinken, oder auch an berufsspezifischen Gesundheitsrisiken bei Personen mit niedrigem Einkommen oder geringerer Bildung.«
Zu den Ergebnissen der Studie von Rau/Schmertmann (2020)
»Basierend auf den für die Jahre 2015–2017 geschätzten Sterberaten hatte Bremerhaven die kürzeste Lebenserwartung, während Männer im Landkreis München davon ausgehen konnten, rund fünf Jahre länger zu leben. Die niedrigste Lebenserwartung für Frauen fanden wir für den Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt, die höchste im Landkreis Starnberg im Südwesten Münchens.«
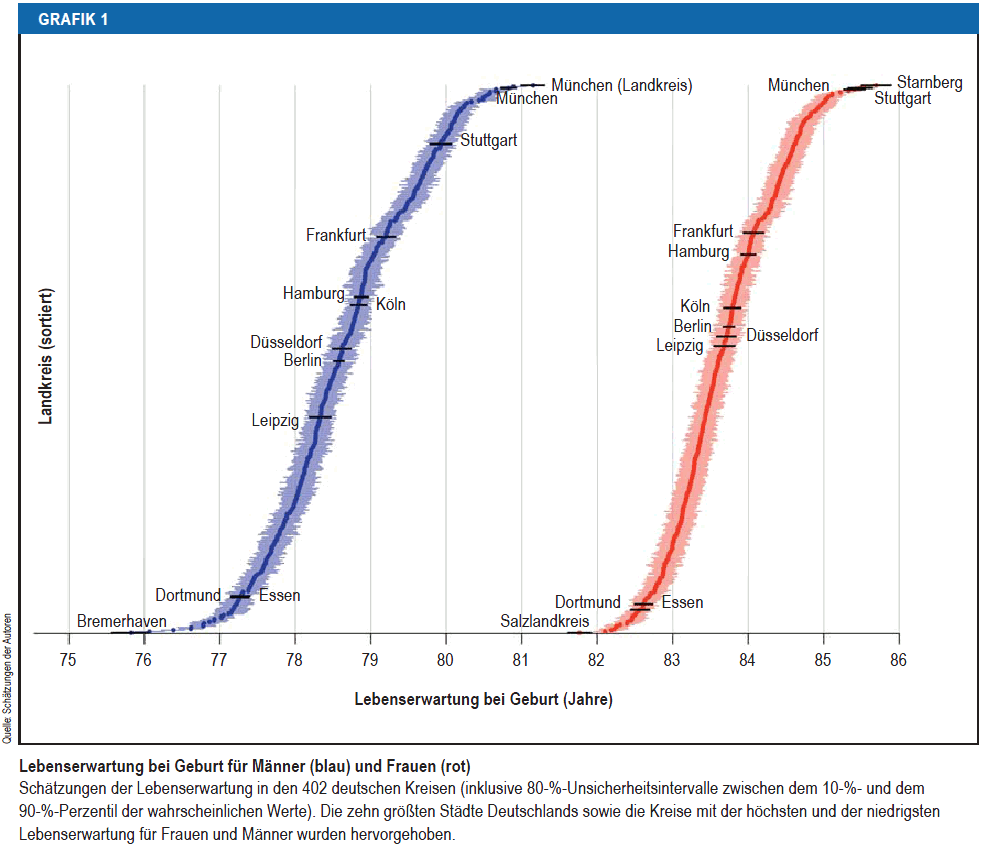
Quelle der Abbildung: Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 493-9; DOI: 10.3238/arztebl.2020.0493
Zu den regionalen Unterschieden bei der Lebenserwartungen, differenzier nach den Geschlechtern, führen Rau/Schmertmann aus, den »Schätzungen zufolge variiert die Lebenserwartung zwischen den Kreisen um mehr als fünf Jahre bei den Männern (5,3 Jahre) und um knapp vier Jahre bei den Frauen (3,9 Jahre). Bringt man dies in einen internationalen Kontext, so entspricht die niedrigste Lebenserwartung für Männer (75,8 Jahre) ungefähr dem Niveau von Oman (Platz 53 der 201 Länder laut Schätzungen der Vereinten Nationen [2]), während die höchste Lebenserwartung (81,2) in etwa der von Australien entspricht (Platz 6). Bei der Lebenserwartung für Frauen ist der Kreis mit der geringsten Lebenserwartung vergleichbar mit der Lebenserwartung tschechischer Frauen (81,8; Platz 46). Die höchste weibliche Lebenserwartung in einem deutschen Kreis ist vergleichbar mit der Lebenserwartung von Frauen in Südkorea (85,7; Platz 5).«
Bereits angesprochen wurde die sozialpolitisch relevante Fragestellung der Studie, ob es bestimmte Korrelationsmuster zwischen sozialen und ökonomischen Indikatoren auf Kreisebene und der dortigen Lebenserwartung gibt. Dazu schreiben die beiden Verfasser der Studie: »Es ist bekannt, dass die ökonomische Entwicklung, lokale Verhältnisse und die Verfügbarkeit von medizinischen Leistungen eine wichtige Rolle für die Lebenserwartung spielen können … Im Folgenden untersuchen wir explorativ, welche Korrelationen zwischen Lebenserwartung auf Kreisebene und sozialen wie ökonomischen Variablen … bestehen.«
Und der erste Blick hinsichtlich der Unterschiede in der Lebenserwartung scheint die allgemeinen Vorstellungen zu bestätigen: Im wohlhabenden Baden-Württemberg und Südbayern leben die Leute länger als im Saarland, dem Ruhrgebiet oder in Ostdeutschland. Dazu die Autoren: »Der positive Zusammenhang zwischen BIP und Lebenserwartung beim Nationenvergleich ist seit Mitte der 1970er Jahre bekannt. Dasselbe Muster ist in unserer Analyse auch zwischen den Kreisen erkennbar. Höhere Wirtschaftskraft fällt mit höherer Lebenserwartung zusammen.«
Aber die folgende Abbildung hebt einen sozialpolitisch höchst relevanten Befund der Studie hervor:
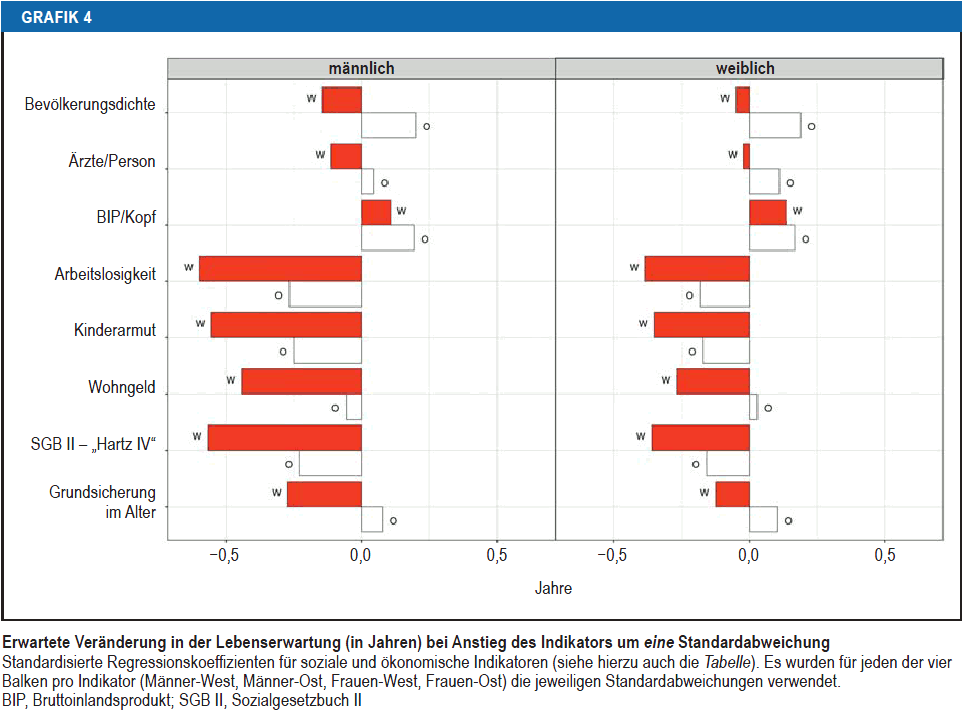
Quelle der Abbildung: Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 493-9; DOI: 10.3238/arztebl.2020.0493
Um die Abbildung richtig interpretieren zu können, muss man sich die Erläuterungen der beiden Autoren anschauen: Die Grafik »zeigt die Stärke der Zusammenhänge zwischen der Lebenserwartung auf Kreisebene und jedem der gewählten Indikatoren. Die Balken im Schaubild repräsentieren standardisierte bivariate Regressionskoeffizienten: die geschätzten Veränderungen in der Lebenserwartung bei einer Zunahme des jeweiligen Indikators um eine Standardabweichung. So ist zum Beispiel der standardisierte Koeffizient für die Arbeitslosenquote von Männern im Westen −0,6. Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit lag bei Männern im Westen bei 5,40 %, mit einer Standardabweichung von 2,47 % (siehe Tabelle). Das bedeutet, dass eine Differenz von 2,47 % in der Arbeitslosigkeit zwischen zwei Kreisen im Westen einer Lebenserwartung entspricht, die 0,6 Jahre niedriger liegt als im Kreis mit der höheren Lebenserwartung.«
Offensichtlich gibt es einen „Geschlechter-Effekt“: So sind die gewählten Indikatoren stärker mit der Lebenserwartung für Männer korreliert als mit der Lebenserwartung für Frauen. Das wird auch durch andere Studien bestätigt: Auf Individualdaten basierende Longitudinalstudien der Sterblichkeit zeigen häufig, dass soziale, demografische und ökonomische Bedingungen bei Männern einen stärkeren Effekt nach sich ziehen.
Die Korrelationen zwischen Bevölkerungsdichte, Arztdichte und Lebenserwartung sind relativ gering. »Die Daten … zeigen auch, dass ökonomische Indikatoren weitaus stärkere Prädiktoren für die Lebenserwartung sind als Bevölkerungsdichte und die Zahl der Allgemeinärzte pro 100.000 Einwohner.«
»Korrelationen zwischen Lebenserwartung und Bevölkerungsdichte, Arztdichte und BIP sind jedoch relativ gering, wenn man sie mit ökonomischen Indikatoren vergleicht, die sich auf besonders benachteiligte Einwohner eines Kreises beziehen … Indikatoren wie Arbeitslosenquote, Wohngeld und weitere öffentliche Unterstützungsleistungen haben erheblich höhere (und durchgehend negative) Korrelationen mit der Lebenserwartung auf Kreisebene. Es ist ebenfalls interessant zu sehen, dass Arbeitslosigkeit und Transferleistungen einen stärkeren Zusammenhang mit niedriger Lebenserwartung im Westen Deutschlands aufweisen.«
Rau und Schmertmann heben hervor, »dass es nicht die durchschnittlichen ökonomischen Bedingungen sind, die die Lebenserwartung beeinflussen, sondern eher die Lebensumstände von Personen am unteren Ende des sozioökonomischen Spektrums.«
In der Zusammenfassung wird ausgeführt: »Wir finden keine durchgängigen Stadt-Land-Unterschiede bei der Lebenserwartung. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Maßnahmen, die die Lebensstandards für ärmere Teile der Bevölkerung verbessern, am ehesten dazu geeignet sind, die existierenden Unterschiede in der Lebenserwartung zu reduzieren.«
In anderen Worten: Gezielte und wirkkräftige Interventionen zugunsten der Lebenslagen der ärmeren Bevölkerungsteile könnten zu einem Abbau der Lebenserwartungsunterschiede führen – was aber nicht automatisch heißen muss, dass es eine Einebnung geben wird, wenn man die Verhältnisse entsprechend verändert. Natürlich gibt es weiterhin auch die Verhaltensebene als Einflussfaktor auf die Entwicklung der Lebenserwartung. Und korrekt, wie die beiden Wissenschaftler sind, weisen sie auf diese auch in ihrer Studie offene Flanke hin: »Wichtige Beispiele für weitergehende Forschungsinitiativen wären eine detailliertere Analyse der Sterblichkeit in unterschiedlichen Altersgruppen oder auch die Einbindung von Lebensstilfaktoren wie die Prävalenz von Rauchen, Alkoholkonsum oder physische Aktivitäten.« Anders formuliert: Die Forschungserwartung steigt auf alle Fälle.