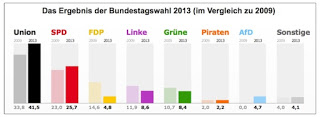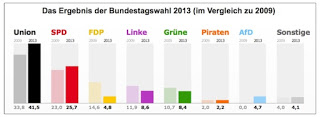Wie auch immer die genaue Regierungskonstellation in der vor uns liegenden Legislaturperiode aussehen wird – die Akteure werden mit einigen großen sozialpolitischen Baustellen konfrontiert sein, denen man nicht auf Dauer wird ausweichen können. Schon viel zu lange wurden und werden wichtige Grundsatzentscheidungen auf die lange Bank geschoben und auch die um sich greifende Seuche einer „Playmobil-Sozialpolitik“ (zu denen ich solche Kreationen wie das Betreuungsgeld oder den Pflege-Bahr zähle) erschweren objektiv die Aufgabenstellung, wieder mehr Ordnung in die sozialpolitischen Systeme zu bringen, denn immer mehr problematische Schnittstellen werden produziert, die zu teilweise skurrilen Folgen führen, die dann erneute Partikular-Maßnahmen auslösen.
Insofern stellt sich anlässlich der Bundestagswahl die – natürlich nur in sehr groben Linien skizzierbare – Frage, mit welchen grundsätzlichen Themen und Arbeitsaufträgen sich die neue Bundesregierung wird auseinandersetzen müssen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sollen im folgenden Beitrag einige große Schneisen in das sozialpolitische Dickicht geschlagen werden.
Eine der wichtigsten
Herausforderungen betrifft die Pflege. Und dies nicht nur im Sinne einer
sofortigen Engführung auf die sicher sehr wichtige Pflegeversicherung und deren
Weiterentwicklung bzw. Umbau. Damit soll angedeutet werden, dass für die
Sicherstellung und nachhaltige Gewährleistung einer menschenwürdigen Pflege zur
Kenntnis genommen werden muss, dass diese Mega-Aufgabe nicht in oder von einem
System bewältigbar ist, sondern das kann praktisch nur in einem vielgestaltigen
Mix in konkreten sozialräumlichen Bezügen geleistet werden, wo die Leistungen
der Pflegeversicherung eine wichtige, aber eben nur eine anteilige Rolle
spielen. In diesem Kontext wird es um höchst komplexen Fragen der
Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen gehen müssen, also neben der
stationären und häuslich-ambulanten Pflege die Entstehung und
Ausdifferenzierung zahlreicher neuer Formen der Pflege und Betreuung. Bereits
heute müssen die Bundesländer Antworten geben, wie sie denn neben den
„klassischen“ Heimen und Pflegediensten mit Wohngemeinschaften und anderen
Formen umgehen wollen. In diesem Zusammenhang wird eine der großen Aufgaben der
vor uns liegenden Jahre der Auf- und Ausbau von Tageseinrichtungen gerade für
die vielen Menschen am Anfang oder im mittleren Stadium einer demenziellen
Erkrankung sein – und an diesem Beispiel kann man zugleich zeigen, was
besonders Not tut in der höchst versäulten und aussegementierten
Soziallandschaft: Feldübergreifendes, vernetztes Denken. Konkret: Von den
Erfahrungen, die wir in vielen Jahrzehnten mit der Tagesbetreuung für Kinder
und aktuell gerade mit der von sehr kleinen Kindern gemacht haben, für die
notwendigen Strukturen und Prozesse für die älteren Menschen lernen,
idealerweise die Strukturen verbinden und einer gemeinsamen Nutzung zuführen.
Im Ergebnis bedeutet das alles, dass wir eine starke Rolle der Kommunen in
diesen Bewältigungsprozessen brauchen werden.
Für den Sozialpolitiker
keine Frage: In der neuen Legislaturperiode müssen endlich die jahrelangen
Vorarbeiten zur Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsgesetzes in die
Wirklichkeit gehoben werden. Weitere Verzögerungen seitens der Politik müssen
als vorsätzliches Handeln bezeichnet und skandalisiert werden. Das bedeutet
natürlich auch eine Mittelaufstockung für den Bereich der Pflege – auch und
gerade in Verbindung mit der unbedingt erforderlichen Verbesserung der
Arbeitsbedingungen für die Professionellen in diesem Feld, womit nicht nur eine
bessere Vergütung, sondern auch bessere Personalschlüssel gemeint sind. Das
wird – man kann es drehen und wenden wie man will – keine billige oder gar
„aufkommensneutrale“ Angelegenheit werden.
Darüber hinaus wird man
um eine offene Grundsatzdiskussion über die Existenz und konkrete Ausgestaltung
der sozialen Pflegeversicherung nicht herum kommen, hier gemeint im Sinne einer
Infragstellung der Separierung von Pflege- und Krankenversicherung. Man wird in
der alternden Gesellschaft die Frage stellen dürfen und müssen, ob es
angesichts der vielen fließenden Übergänge und der bereits heute bestehenden
und vielseits beklagten Verschiebebahnhöfe zwischen den beiden
Versicherungszweigen nicht sinnvoller wäre, beide Systeme zu integrieren in
einem neuen Sicherungsgebilde.
Wenn wir schon an der
Schnittstelle zur Gesetzlichen Krankenversicherung und damit mittendrin im
großen Formenkreis der Gesundheitspolitik sind, dann kann man auch hier einige
Hinweise geben. Weiter und mit zunehmender Dringlichkeit wird es um die Frage
nach der (Nicht-)Zukunft des dualen Krankenversicherungssystems gehen. Man kann
parteipolitische Kampfbegriffe wie „Bürgerversicherung“ entsorgen – aber die
grundsätzliche Frage nach der Sinnhaftigkeit oder ganz unideologisch nach der
Überlebensfähigkeit des privaten Krankenversicherungssystems werden sich nicht
in Luft auflösen. Die Zeichen stehen auf einen Systemwechsel und man sollte das
lieber früher als zu spät machen. Darüber hinaus stellen sich weitere große
Herausforderungen, beispielsweise im Bereich der Krankenhausfinanzierung. Auch
hier darf und muss man systemische Fragen stellen, so nach der Notwendigkeit
und Möglichkeit eines sektorübergreifenden Finanzierungssystems. Vor dem
Hintergrund der Sicherstellungsprobleme, die wir heute schon und zunehmend
haben auch aufgrund der immer noch starren Trennung zwischen ambulanter und
stationärer Versorgung wird man sich nicht nur modellhafte, sondern
systematische Gedanken machen müssen über die (Nicht)Zukunftsfähigkeit der
ärztlichen Einzelpraxen und mutigerer Schritte hin zu neuen Versorgungsformen.
Damit unlösbar einhergehend brauchen wir endlich eine systematische Entwicklung
des weiten Feldes der Gesundheitsberufe neben den Ärzten, hier gemeint im Sinne
einer systematischen Aufwertung und auch größerer Delegation bislang ärztlicher
Leistungen an anderer Berufsgruppen. Anders werden sich die Versorgungsaufgaben
gar nicht lösen lassen. Das ganze Thema ist komplex und besonders vermint
aufgrund der erheblichen Interessenkonflikte und Machtspielereien. Eigentlich
notwendig wäre die gemeinsame Ausbildung der Gesundheitsberufe an einer
„Medical School“, um die Homogenisierung des Arztberufs schon während des
Studiums aufzubrechen.
Kommen wir zu einer
weiteren Großbaustelle (und das hoffentlich nicht im Sinne von Stuttgart 21
oder dem angeblich im Bau befindlichen Berliner Großflughafens): Arbeitsmarkt
und Arbeitsmarktpolitik. Hier besteht ganz offensichtlich einer erheblicher
Bedarf an einer umfassenden Ordnungspolitik und diese gerade nicht nur
beschränkt auf die unteren Etagen des Arbeitsmarktes. Das kann man am höchst
aktuellen Beispiel der zunehmenden Instrumentalisierung von Werk- und
Dienstverträgen verdeutlichen, von denen eben nicht „nur“ osteuropäische
Wanderarbeiter in den deutschen Billigschlachthöfen betroffenen sind, sondern
die sich immer mehr in die Kernbereiche der Belegschaften hineinfressen, man schaue
sich beispielsweise nur die Situation vieler Ingenieure in der
Automobilindustrie an. Die Re-Regulierung der Leiharbeit und die Regulierung
der Werkverträge werden sicher eine prominente Rolle in der kommenden
Legislaturperiode bekommen. Daneben geht es um eine grundsätzliche kritische
Infragestellung der 450-Euro-Jobs gerade angesichts der Verwüstungen, die diese
Beschäftigungsform in vielen Frauenbiografien anrichtet. Es geht natürlich auch
um die hoch aufgeladene Frage nach einem Mindestlohn bzw. ganz vielen einzelnen
Lohnuntergrenzen. Hier sollte man von den Erfahrungen in anderen Ländern
lernen. Aber „nur“ mit einem Mindestlohn bzw. darauf aufsetzend vielen
branchenbezogenen Mindestlöhnen alleine wird es nicht getan sein. Man wird auch
über die Struktur und den Verbindlichkeitsgrad des Tarifsystems nachdenken
müssen, beispielsweise über eine wieder stärkere Nutzung des Allgemeinverbindlichkeitsinstrumentariums.
Eine zentrale Erkenntnis aus vielen Jahren Befassung mit dem Arbeitsmarkt
lautet: Keine Engführung auf nur partikulare Regulierungsversuche, die – siehe
derzeit die Erfahrungen mit der „Verteuerung“ der Leiharbeit – sofort zu
Ausweichreaktionen bei einem Teil der Unternehmen führen werden.
Wenn wir von Arbeitsmarkt
und Arbeitsmarktpolitik reden, dann können und dürfen wir vom
Grundsicherungssystem nach dem SGB II nicht schweigen – außer man gibt sich der
leider gar nicht so selten anzutreffenden Selbstillusionierung hin, wir haben
Vollbeschäftigung und das Arbeitslosigkeitsproblem werde sich jetzt gleichsam
biologisch durch Verschwinden dieser Spezies „lösen“. Dem ist nicht so und das
wird auch nicht passieren. Ganz im Gegenteil haben wir bereits in den
zurückliegenden Jahren eine massive Polarisierung in diesem Bereich sehen
müssen. Dies in dem Sinne, dass sich die Situation für viele Menschen, die nur
kurzfristig arbeitslos sind, tatsächlich deutlich verbessert hat, während
gleichzeitig eine massive Verhärtung der Langzeitarbeitslosigkeit im
Grundsicherungssystem festzustellen ist. Gleichzeitig sind die zur Verfügung
stehenden finanziellen Mittel sowie – eigentlich noch schlimmer – die
förderrechtlichen Rahmenbedingungen für eine Arbeitsmarktpolitik, die sich vor
allem auf den harten Kern der Langzeitarbeitslosen bezieht, erheblich
schlechter geworden. In diesem Teilbereich wird eine der dringlichsten Aufgaben
eine umfassende Reform der öffentlich geförderten Beschäftigung sein, wenn man
nicht jeden Rest von Teilhabeorientierung für die von Langzeitarbeitslosigkeit
betroffene Menschen entsorgen will. Entsprechend ausgearbeitete und gut
begründete Reformkonzepte für eine öffentlich geförderte Beschäftigung, die den
Erwartungen und Notwendigkeiten der besonderen Zielgruppe entsprechen würde,
liegen seit Jahren vor. Ganz offensichtlich haben wir hier neben
Systemproblemen innerhalb des SGB II vor allem ein normatives oder sagen wir es
deutlicher: ein ideologisches Problem.
Zum Thema Arbeitsmarkt
und Arbeitsmarktpolitik gehören aber auch immer konfliktärer werdende
systematische Fragen im Bereich der Ausbildung, sowohl an der ersten Schwelle,
also beim Übergang von der Schule in den Beruf, wie auch insgesamt beim
Verhältnis von dualer bzw. fachschulischer Berufsausbildung und der immer
stärker werdenden Akademisierung in unserer Gesellschaft. Eines der größten
Herausforderungen in den vor uns liegenden Jahren wird die Bewältigung des
doppelten Drucks auf das gewachsene System der dualen Berufsausbildung sein,
also dass immer mehr junge Menschen nicht nur formal die Hochschulreife
erwerben, sondern auch ein Studium aufnehmen, während gleichzeitig eine Öffnung
der Berufsausbildung nach unten, also in Richtung der „leistungsschwächeren“
Jugendlichen aufgrund der kognitiven Aufladung viele Berufsbilder schwer,
manchmal gar nicht möglich ist. Diese strukturellen Herausforderungen des
dualen Berufsausbildungssystems verbinden sich mit der demografischen
Entwicklung, die zu einer erheblichen Angebots-Nachfrage-Verschiebung
zuungunsten der Unternehmen geführt hat, die sich in den vor uns liegenden
Jahren weiter verstärken wird. Die bereits heute erkennbare und – wenn sich
nichts grundlegendes ändert – weiter zunehmende Schwächung des dualen
Berufsausbildungssystems wird sich besonders negativ bemerkbar machen, weil
zahlreiche Handwerker und Facharbeiter, die heute das Rückgrat der deutschen
Volkswirtschaft bilden, demnächst altersbedingt in den Ruhestand gehen werden. Der
vielbeschworene Fachkräftemangel wird weniger einer der akademischen Berufe
sein, sondern sich im Handwerk und im mittleren Segment der deutschen Industrie
abspielen. Aber selbst innerhalb des Hochschulsystems gibt es erhebliche
Zweifel an dem bislang eingeschlagenen Weg, als Stichwort sei hier nur die
Bologna-Reform genannt. Ganz offensichtlich haben die deutschen Hochschulen den
Systemwechsel, der mit der Bologna-Reform verbunden ist, dergestalt umgesetzt,
dass die Bachelor-Studiengänge in einer unglaublichen Heterogenität
ausgestaltet werden, teilweise mit einer extremen Hyper-Spezialisierung, die
möglicherweise den aktuellen, kurzsichtigen Interessen einer Branche oder
zuweilen nur einzelner Unternehmen entsprechenden mag, was sich aber mittel-
und langfristig bitter rächen kann hinsichtlich der Beschäftigungsfähigkeit der
so ausgebildeten jungen Menschen.
Wenn wir über
Berufsausbildung und Hochschulbildung sprechen, dann sind wir im großen
Formenkreis von Bildung und Betreuung angekommen. Hier dominierten in den
vergangenen Jahren der Ausbau der Kindertageseinrichtungen und der
Kindertagespflege, Stichwort: Ausbau der Betreuungsangebote für die unter
dreijährigen Kinder, die Diskussion. Nach der formalen Inkraftsetzung des
Rechtsanspruchs auf ein Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
muss es in den vor uns liegenden Jahren um eine „Aufpolsterung“ der
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege gehen. Dies meint eine
deutliche Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen in den Einrichtungen
und in der Tagespflege, also vor allem hinsichtlich der Personalschlüssel sowie
der Arbeitsbedingungen für die dort arbeitenden Fachkräfte. Angesichts der
besonderen Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Bildung, Betreuung und
Erziehung für die Kleinkinder ist es unausweichlich, dass die seit langem
diskutierten und wissenschaftlich abgesicherten Qualitätsanforderungen in einem
bundesweiten Qualitätsgesetz für den Kita-Bereich normiert werden, dies auch
vor dem Hintergrund der erheblichen Varianz der Rahmenbedingungen zwischen den
Bundesländern. Ein auf der Bundesebene normiertes Qualitätsgesetz für diesen
Bereich würde zugleich die dringend notwendige Finanzierungsreform
vorantreiben. Hier muss es um eine regelhafte Beteiligung des Bundes an den
laufenden Kosten der Kindertagesbetreuung gehen. Diese hier nur anzudeutenden
offenen Strukturprobleme im Bereich der Kindertagesbetreuung pflanzen sich fort
im Schulsystem, das mit den gleichen föderalen Problemen durchsetzt ist. Mittlerweile
gibt es konkrete Forderungen, als nächste Stufe der Entwicklung einen
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz verbindlich zu normieren. An dieser
Stelle muss dringend darauf hingewiesen werden, dass dies zwar ein logischer
Schritt in der Entwicklung wäre, man aber auf keinen Fall die gleichen Fehler
wie bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für die
kleinen Kinder machen sollte. Dies bedeutet konkret, dass vor einem solchen
Rechtsanspruch nicht nur die finanziellen Fragen der Mittelaufbringung und
Mittelverteilung geklärt werden müssen, sondern vor allem auch die personellen
Voraussetzungen. Wer soll das machen und wie viele brauchen wir für die
Erfüllung eines solchen Rechtsanspruchs?
Gerade der Ausbau der
Kindertagesbetreuung sowie die damit zusammenhängende Einführung des unseligen
Betreuungsgeldes verweisen auf das Feld der Familienpolitik. Hier müsste jedem
unbefangenen Beobachter deutlich geworden sein, auch durch die mittlerweile
vorliegenden Ergebisse einer umfassenden Evaluierung der existierenden
familienpolitischen Leistungen, dass wir es mit einem Wirrwarr an
unterschiedlichen Leistungen, vor allem Geldleistungen, zu tun haben, die
dringend einer systematischen Neuordnung bedürfen, dies zu einem im Sinne einer
zielorientierten Zusammenlegung der vielen einzelnen Leistungen. Zum anderen
muss vor dem Hintergrund der erschreckenden „Infantilisierung“ der Armut über
die Einführung einer Kindergrundsicherung diskutiert werden. Die Einführung
einer solchen Kindergrundsicherung hätte übrigens erhebliche positive
Auswirkungen in anderen Teilbereichen der Sozialpolitik, man denke hier an die
zahlreichen Aufstocker im Grundsicherungssystem, von denen viele deswegen
aufstocken müssen, weil der bestehende Familienlasten- und -leistungsausgleich
defizitär ist.
Gerade für die finanziell
schwach aufgestellten Familien wird sich das Themenfeld Wohnen als neue soziale
Frage in den vor uns liegenden Jahren besonders schmerzhaft ausformen. Hier
wird es in der nächsten Legislaturperiode deutliche Eingriffe in den
Wohnungsmarkt geben müssen, die allerdings recht komplex und mit zahlreichen
Nebenwirkungen versehen sein werden. Dies gilt vor allem für Instrumente, die
derzeit von den politischen Akteuren besonders gerne diskutiert werden,
beispielsweise eine Anhebung des Wohngeldes. Die Verantwortlichen werden
eingestehen müssen, dass der massive Abbau der sozialen Wohnungsbauförderung in
den vergangenen Jahren im Zusammenspiel mit den vielen aus der Sozialbindung
herausfallenden Wohnungen dazu führen wird, dass wir eine neue
wohnungspolitische Offensive im Sinne des Baus neuer Sozialwohnungen benötigen.
In diesem Themenfeld ist auch die neue Diskussion einzuordnen, die unter dem
Stichwort „Energiearmut“ geführt wird und die im Zusammenhang mit dem Ausbau
und der Förderung der erneuerbaren Energien stehen. Die damit verbundenen
Kostensteigerungen für die Privathaushalte treffen die finanziell schwach
aufgestellten Haushalte ganz besonderes und werden das Problem der zunehmenden
Wohnungsnot weiter vorantreiben.
Auf der sozialpolitischen
Agenda kann und darf natürlich das Thema Alterssicherung und Rente nicht fehlen. Hier
erleben wir bereits derzeit und in den kommenden Jahren immer stärker die
Zuspitzung der „Systemfrage“ in der Gesetzlichen Rentenversicherung aufgrund
der zahlreichen Rentenreformen in der Vergangenheit, insbesondere die Eingriffe
der damaligen rot-grünen Bundesregierung um die Jahrtausendwende. Mit
Systemfrage ist an dieser Stelle gemeint, dass die zentralen
Konstruktionsprinzipien der Funktionsfähigkeit der umlagefinanzierten
gesetzlichen Rentenversicherung durch die Rentenreformen, aber auch durch die
gesellschaftlichen Veränderungen fundamental infrage gestellt werden. Denn die
immer mehr zu einer Kunstfigur werdende Person des deutschen „Eckrentners“, der
45 Jahre lang immer und ohne Unterbrechungen Beiträge auf der Basis des
durchschnittlichen Arbeitseinkommens eingezahlt hat (und der derzeit daraus
eine Brutto-Monatsrente in Höhe von etwas mehr als 1.100 € erhält), wird
zunehmend abgelöst von Menschen, die aufgrund ihrer brüchigen Erwerbsbiografien
und/oder niedriger Arbeitsentgelte diese Voraussetzungen nicht mehr werden
erfüllen können. In Verbindung mit der massiven Absenkung des Rentenniveaus
durch die so genannten Rentenreformen wird hier der Marsch in die Altersarmut
für sehr viele ältere Menschen, vor allem für Menschen aus dem
Niedriglohnbereich, unausweichlich, wenn sich nicht grundlegendes mehr an der
Mechanik des Rentensystems ändert. In der kommenden Legislaturperiode muss
verhindert werden, dass es zu einer Verengung auf eine „Lösung“ gibt, die den
betroffenen Menschen eine Rente garantieren will, die gerade etwas über der
Grundsicherung im Alter liegt, die auch die bekommen, die ihr Leben lang nicht
gearbeitet haben. Hier muss es zu einem Lösungsansatz kommen, der deutlich über
diesem minimalistischen Ansatz liegt. Ein Blick in andere Länder, hier
beispielsweise der Schweiz mit ihrer Basisrente in einem stark umverteilenden
Alterssicherungssystem, wäre hilfreich.
Auch die teilweise recht
problematischen Entwicklungen im Bereich der privaten Altersvorsorge, die mit
Milliarden Steuermitteln gefördert wird, also die „Riester-Rente“ wie aber auch
die Entgeltumwandlung im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, gehören in
der kommenden Legislaturperiode auf dem Prüfstand. Insgesamt – das zeigen auch
die Erfahrungen der Länder mit starken kapitalgedeckten
Alterssicherungssystemen im Gefolge der Finanzkrise und der nun schon seit
Jahren und absehbar weiter anhaltenden Niedrigzinswelt – muss es um eine
deutliche Stärkung der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung
gehen.
Eine besondere
Herausforderung wird in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund der deutlichen
Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters (Stichwort: Rente mit 67) die
Lösung des Problems darstellen, dass es viele Menschen gibt, die tatsächlich
nicht in der Lage sind bzw. sein werden, das gesetzliche Renteneintrittsalter
erreichen zu können. Hier müssen flexible Lösungen für eine adäquate
Absicherung der Betroffenen gefunden werden.
Wenn wir über
Alterssicherung sprechen, dann sprechen wir immer auch über eine eigenständige
Säule der Alterssicherung in Deutschland, also die Pensionen für die Beamten.
Hier nun sind wir nicht nur mit einer generellen Zunahme der Pensionäreund der
damit verbundenen Pensionsverpflichtungen, die auf dem laufenden
Steueraufkommen gedeckt werden müssen, konfrontiert, sondern vor allem mit
einem großen Sprengsatz für die Haushalte der Bundesländer. Denn die meisten
Beamten, dann denke hier an die vielen Lehrer, Polizisten, Hochschullehrer,
Richter, sind Beamte der Bundesländer. Viele von ihnen wurden in den 1970er
Jahren eingestellt und viele von ihnen werden in den kommenden Jahren in die
Pension wechseln. Unter sonst gleichbleibenden Bedingungen würde diese
Entwicklung die meisten Länderhaushalte komplett paralysieren.
Nein, die notwendige dem
Palette für die vor uns liegenden Jahre ist noch nicht abgearbeitet. Ebenfalls
eine Mega-Baustelle wird der gesamte Bereich der so genannten Inklusion
darstellen. Die Diskussion über die Umsetzung von Inklusion wird in Deutschland
sehr schullastig geführt, was vor dem Hintergrund des stark separierenden
Schulsystems bei uns, Stichwort Förderschulen, auch nicht überrascht. Alleine
die Umsetzung von inklusiven Ansätzen in den Schulen wird zu einer herkulischen
Aufgabe werden. Aber darüberhinaus betrifft die Inklusion weitaus mehr Bereiche
als nur die Schule. Es geht um eine umfassende Teilhabeorientierung und die
lässt sich eben nicht begrenzen auf die Frage der Inklusion behinderter Kinder
und Jugendliche in unsere Regelschulen, sondern sie strahlt aus in viele andere
Bereiche, man denke hier nur an die Arbeitswelt.
Und mit einer gewissen
Zuspitzung kann man eine weitere, ebenfalls nur in Querschnitten bearbeitetbare
Aufgabe als eine inklusive wahrnehmen: Gemeint ist hier das gesamte Feld der
Integration von „Menschen mit Migrationshintergrund“, wie das heute oftmals
etwas verquast genannt wird. Und die Aufgaben, die sich hier zum einen mit
Blick auf die in unserem Land bereits teilweise seit vielen Jahren lebenden
Menschen stellen, wie auch angesichts des erwartbaren Zuwanderungsdrucks vor
dem Hintergrund des großen Wohlstandsgefälles innerhalb der Europäischen Union,
sind enorm. Hinzu kommt erwartbar eine wieder deutlich ansteigende Zahl an
Flüchtlingen und Asylbewerbern aufgrund der großen Wanderungsströme, die wir
beobachten müssen.
Wer bis zu dieser Stelle
durchgehalten hat, der wird sicherlich überwältigt sein von der
Vielgestaltigkeit der sozialen Aufgaben und Herausforderungen, die
thematisiert, eingeordnet, bearbeitet oder wenigstens zur Diskussion gestellt
werden müssten. All diese Themen und Aufgaben und offenen Fragen treffen nun
zum einen auf zahlreiche versäulte Institutionen, die nachvollziehbarerweise
ihr Eigenleben führen und an ihrer Existenzberechtigung arbeiten, auf der
anderen Seite ist auch der sozialpolitische Sach- und Fachverstand in einem
zunehmenden Maße kleinteilig strukturiert. Ganz offensichtlich fehlt es nicht
nur innerhalb der Politik, sondern auch und gerade in der Wissenschaft und
Beratung an ganzheitlich ausgerichteter sozialpolitischer Expertise. Je
komplizierter aber die gewachsenen Teilsysteme geworden sind, je mehr Anreicherungen
stattfinden, und je stärker die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen
Teilsystemen ist, umso störungsanfälliger wird das gesamte Sozialsystem. Dies
lässt sich ab einem bestimmten Komplexitätsgrad natürlich nicht vermeiden oder
gar aufheben, aber wir brauchen dringend ein stabiles Netzwerk für eine
umfassende sozialpolitische Begleitung dieser ineinander verschachtelten
Prozesse.
In diesem Kontext gehört
auch die Forderung, die bestehende und äußerst asymmetrische
Kosten-Nutzen-Wahrnehmung der Sozialpolitik und ihrer Leistungen vom Kopf auf
die Füße zu stellen: Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass gegenwärtig
Sozialpolitik und soziale Leistungen fast ausschließlich als Kostenproblem
wahrgenommen werden. Viel zu wenig und in nicht wenigen Fällen sogar gar nicht
berücksichtigt werden aber die Nutzeneffekte, die wir durch diese Leistungen
generieren beziehungsweise ermöglichen. Wenn es uns in den kommenden Jahren
nicht weitaus stärker als bisher gelingt, eine „richtige“, zumindest eine korrekterer Kosten-Nutzen-Betrachtung
der Sozialpolitik und der dort geleisteten Arbeit, durchaus auch in einer
monetarisieren Art und Weise, also in Geldeinheiten ausgedrückt, zu entwickeln
und zu kommunizieren, dann werden die aus einer gegebenen Haushaltslogik
abgeleiteten reflexartigen Angriffe auf die Substanz vieler sozialpolitischer
Handlungsfelder noch mehr an Gewicht gewinnen.