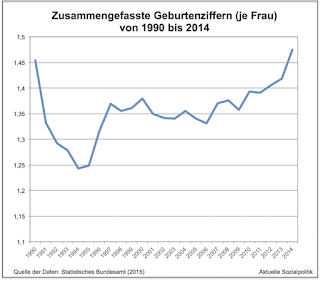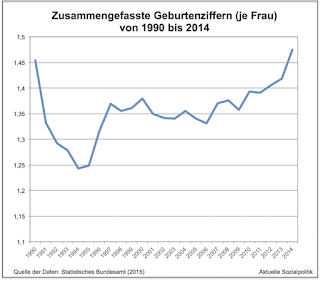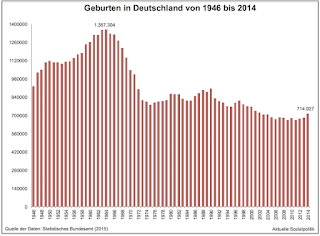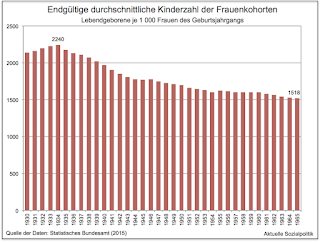Es ist ein seit Jahren wiederkehrendes Ritual: Bei der Diskussion über Armut und Armutsgefährdung taucht eine Gruppe immer ganz vorne auf, wenn es um die besonders betroffenen Menschen geht: Alleinerziehende und ihre Kinder. Und immer folgt sogleich die zuweilen beschämt vorgetragene Litanei, dass es doch nicht sein kann, dass man nur deshalb in Einkommensarmut und im Hartz IV-Bezug leben muss, weil man ein oder mehrere Kinder alleine bzw. überwiegend alleine betreut, erzieht, bildet und was man sonst noch so machen kann mit den Kleinen. »Alleinerziehende, sagt eine neue Studie, geraten aus zwei Gründen oft in Armut: Der Partner zahlt nicht, der Staat zahlt zu wenig und nicht lange genug. Die Politik kennt die Armutsfalle seit Jahren, viel passiert ist nicht«, so Armin Lehmann in seinem Artikel. Bei der von ihm zitierten neuen Studie handelt es sich um ein Update einer Veröffentlichung, deren erste Version bereits 2014 publiziert wurde. Die neue Fassung hat Anne Lenze gemeinsam mit Antje Funke verfasst:
Anne Lenze und Antje Funcke: Alleinerziehende unter Druck. Rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Lage und Reformbedarf, Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung, 2016
Die Bertelsmann-Stiftung hat die Veröffentlichung unter dieser Überschrift begleitet: Alleinerziehende leben fünfmal häufiger in Armut als Paarhaushalte: Bei insgesamt 1,64 Mio. Alleinerziehenden in Deutschland wachsen 2,3 Millionen Kinder in Deutschland in einer Ein-Eltern-Familie auf. Ihnen droht deutlich häufiger ein Leben in Armut als Gleichaltrigen, die mit beiden Elternteilen zusammen leben.
Der Anteil von Alleinerziehenden im SGB-II-Bezug liegt im Bundesdurchschnitt bei 37,6 Prozent – er ist fünf Mal höher als bei Paarhaushalten mit minderjährigen Kindern (7,3 %). Von den insgesamt 1,92 Millionen Kindern und Jugendlichen im SGB-II- Bezug lebt die Hälfte (968.750) in Ein-Eltern-Familien. Kinderarmut ist damit ganz wesentlich auf die Armut von Alleinerziehenden zurückzuführen.
Und in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Situation der Alleinerziehenden hinsichtlich des Armutsrisikos sogar weiter verschlechtert – bei Paarfamilien ist das Armutsrisiko im selben Zeitraum gesunken. Weitere Informationen findet man in der Veröffentlichung Daten zur Lebenslage von alleinerziehenden Familien in Deutschland.
Die in der aktualisierten Studie beschriebenen Faktoren, die zu dieser beklagenswerten Entwicklung führen, verweisen auf die zentrale Bedeutung des defizitären Kindesunterhalts: »Die Hälfte der Alleinerziehenden erhält überhaupt keinen Unterhalt für ihre Kinder. Weitere 25 Prozent bekommen nur unregelmäßig Unterhalt oder weniger als den Mindestanspruch. Die Gründe dafür wurden bislang nicht untersucht. Der fehlende Unterhalt für die Kinder ist eine zentrale Ursache dafür, dass viele Ein-Eltern-Familien nicht über die Armutsgrenze kommen – und das, obwohl mit 61 Prozent die Mehrheit der alleinerziehenden Mütter erwerbstätig ist«, so die Stiftung.
Wie aber kann man das ändern?
Auf der Grundlage der Studie von Lenze und Funcke hat die Stiftung Reformvorschläge
für alleinerziehend Familien vorgelegt. Zeitnah werden die folgenden Veränderungen vorgeschlagen:
»Beim Betreuungsunterhalt für den Elternteil, der mit dem Kind überwiegend zusammenlebt, ist die derzeitige restriktive Regelung abzulehnen: Kinder brauchen Zeit mit ihren Eltern, und diese Fürsorge erledigt sich nicht nebenbei. Eine Vollzeiterwerbs- tätigkeit von alleinerziehenden Müttern und Vätern mit dreijährigen Kindern ist selbst mit einem Kita- Platz oftmals eine große Herausforderung, vor allem, wenn schwierige Familienphasen (wie Trennungen) bewältigt werden müssen, Kinder besondere Aufmerksamkeit benötigen oder mehrere Kinder versorgt werden. Hier muss der Gesetzgeber noch einmal aktiv werden und barunterhaltspflichtige Elternteile für eine gewisse Übergangsphase stärker als bisher am Unterhalt des alleinerziehenden Elternteils beteiligen. Dabei geht es nicht um eine Dauer-Alimentation des betreuenden Elternteils, sondern um eine zeitweilige Unterstützung, bis neue Arrangements gefunden sind.
Die materielle Lage von Ein-Eltern-Familien kann grundlegend nur verbessert werden, wenn der monetäre Bedarf des Kindes von dritter Seite gedeckt wird. Die Höhe des Kindesunterhalts sollte dabei das gesamte Existenzminimum der Kinder decken, auch jene Aufwendungen für die Persönlichkeitsentwicklung, die Freizeitgestaltung und die außerhäusliche Betreuung. Der zunehmenden Entlastung der barunterhaltspflichtigen Elternteile von den Kosten der Erziehung der Kinder ist entgegenzutreten.«
Ein wichtiger Befund ist die Tatsache, dass der Kindesunterhalt regelmäßig nicht oder nicht in vereinbarter Höhe gezahlt wird. Die Reformvorschläge gehen an dieser Stelle von zwei unterschiedlichen Szenerien aus, die unterschiedliche Konsequenzen erfordern:
1. Der Kindesunterhalt wird trotz finanzieller Leistungsfähigkeit des nicht betreuenden Elternteils nicht bzw. nicht in Höhe des Mindestunterhalts gezahlt. In diesem Fall müssen wirksame Durchsetzungsmechanismen der Unterhaltsansprüche eingeführt werden, so dass der Unterhaltspflichtige zahlt und das Geld bei den Kindern ankommt.
2. Der nicht betreuende Elternteil ist nicht zahlungsfähig. Aufgrund eines zu niedrigen Einkommens kann es z. B. unmöglich sein, existenzsichernden Unterhalt für die Kinder zu bezahlen. Das Einkommen reicht dann nicht aus, um zwei Haushalte für die getrennt lebende Familie zu finanzieren. In diesem Fall muss der Staat mit Blick auf das Wohl der Kinder einspringen und den monetäre Bedarf des Kindes durch eine Sozialleistung wie den Unterhaltsvorschuss decken. Beim Unterhaltsvorschuss müssen dafür allerdings die gleichheitsrechtlich bedenklichen Regelungen zu Bezugsdauer und Altersgrenzen wegfallen. Diese Leistung sollte allen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen, für die kein oder ein zu geringer Unterhalt gezahlt wird. Dies wäre ein wirksamer Schritt im Kampf gegen die Kinderarmut.
»Die besondere Lebenssituation alleinerziehender Mütter und Väter müsste im Steuerrecht weiter verstärkt berücksichtigt werden, z. B. in Form einer Dynamisierung des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende. In der gesetzlichen Sozialversicherung sollte das Existenzminimum von Kindern bei der Beitragserhebung freigestellt werden; Alleinerziehende sollten dann bei ausbleibendem Unterhalt des anderen Elternteils den gesamten Freibetrag geltend machen können. Dadurch würde sich ihr verfügbares Einkommen deutlich erhöhen.«
Und dann kommt aus sozialpolitischer Sicht ein wichtiger Vorstoß:
»Im Sozialrecht muss das Leistungsgeflecht aus Grundsicherung, Mehrbedarfszuschlag, Kinderzuschlag, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss etc. vereinfacht werden. Das Zusammenspiel dieser Fördermöglichkeiten und die unterschiedlichen Anrechnungsmodalitäten tragen aktuell dazu bei, dass gerade Alleinerziehende in der „Sozialleistungsfalle“ gefangen sind und dem SGB-II-Bezug oft nicht entkommen. Bei zukünftigen Reformen des Kinderzuschlags sollte z. B. eine Auszahlung des Mehrbedarfszuschlags im Rahmen des Kinderzuschlags ermöglicht werden. Mittelfristig ist daran zu denken, bestimmte kindbezogene Leistungen zusammenzufassen und durch eine Behörde administrieren zu lassen.«
Das verweist auf das schon vor vielen Jahren vorgeschlagene Modell einer „Kinderkasse“ oder wie man das auch immer nennen würde. Die Vorschläge werden abgerundet mit einem Blick nach vorne: »Langfristig ist es sinnvoll, ein neues Konzept der Existenzsicherung von Kindern einzuführen.
Dabei muss es das Ziel sein, allen Kindern gutes Aufwachsen und faire Bildungs- und Teilhabechancen zu ermöglichen. Ein solches Konzept muss die altersgerechten Bedarfe, Rechte und Interessen von Kindern in den Mittelpunkt rücken – unabhängig von der Familienform, in der die Kinder leben.« Hier drängt sich der Bezug auf das Modell einer Kindergrundsicherung auf.
Die politische Diskussion nach der Veröffentlichung der Studie hat sich fokussiert auf den Unterhaltsvorschuss, berichtet beispielsweise Armin Lehmann. Zu diesem Instrument – geregelt im Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) – muss man wissen: »Zahlt der unterhaltspflichtige Elternteil nicht, das sind zu 90 Prozent Männer, können Alleinerziehende den sogenannten Unterhaltsvorschuss beantragen. Das sind 145 Euro bis zum Alter von fünf Jahren, 190 Euro von sechs bis zwölf. Danach zahlt der Staat diesen Unterhaltsvorschuss nicht mehr. Außerdem wird er nur maximal sechs Jahre gewährt.« Von dem Vorschuss wird zudem das Kindergeld in voller Höhe abgezogen. Ganz offensichtlich gehen die Regeln zum Unterhaltsvorschuss an der Lebensrealität der Betroffenen vorbei. Kinder nach der Vollendung des 12. Lebensjahrs und Jugendliche fallen aus dem System. Dazu auch der Artikel Nur nicht abrutschen von Silke Hoock.
Die Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) hat sich bereits zu Wort gemeldet: „Der Unterhaltsvorschuss muss von 12 auf 14 angehoben werden. Außerdem muss der Unterhalt konsequenter eingefordert werden“, so wird sie zitiert. In einem anderen Artikel wird berichtet: »Die Union signalisierte grundsätzlich Unterstützung. „Über mögliche Verbesserungen beim Unterhaltsvorschuss sollten wir genauso nachdenken wie darüber, wie die Rückholquote für den vom Jugendamt gezahlten Unterhaltsvorschuss von den unterhaltspflichtigen Vätern oder Müttern verbessert werden kann“, erklärte die stellvertretende Vorsitzende der Union-Bundestagsfraktion, Nadine Schön (CDU).«
Das hört sich nicht nur nicht wirklich mutig und konsequent an, das ist es auch nicht. Insofern steht zu befürchten, dass sich die Murmeltier-Schleife weiter drehen wird.